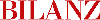Zwar hat sich das Aktionariat klar für den CEO Philippe Donnet ausgesprochen – doch sein Widersacher Francesco Caltagirone wird nicht einfach aufgeben.
Der fromme Gründer von Archegos Capital ist vor gut einem Jahr mit gewaltigen Fehlspekulationen auf Grund gelaufen. Inzwischen ist er wegen Wertpapierbetrugs und Erpressung angeklagt worden.
Nach Wirecard nun Adler? Am Freitagabend hat KPMG dem angeschlagenen Konzern den Jahresabschluss verweigert. Zudem konnten seit längerem bestehende Betrugsvorwürfe nicht zur Zufriedenheit der Aktionäre geklärt werden. Ausgelöst wurde die Affäre durch den Short Seller, der auch bei Wirecard mitmischte.
Hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und Pandemierestriktionen in China haben den Geschäftsgang der Tech-Riesen im ersten Quartal teilweise belastet. Einig sind sich die CEO darin, dass dies in den kommenden Monaten noch schlimmer werden dürfte.
Axel Lehmann erklärt, warum er die Grossbank wieder auf dem Weg in normalere Zeiten sieht, wie er Aktionäre und Mitarbeiter bei der Stange hält und wieso er Konzernchef Thomas Gottstein nicht ersetzt. Das erste Interview mit dem neuen CS-Präsidenten.
Riesige Solarkraftwerke in den Alpen sind der neuste Hoffnungsträger für die «Energiewende», weil sie vergleichsweise viel Winterstrom liefern. Doch ist das Bauen am Berg deutlich teurer als im Flachland.
Afrika hat grosse unerschlossene Gas- und Ölreserven. Doch den Export nach Europa hochzufahren, ist nicht einfach.
Der österreichische Energiekonzern muss russisches Gas wie andere in Rubel bezahlen. Offenbar ist aber immer noch nicht klar, wie die Transaktionen abgewickelt werden können, ohne die Sanktionen der EU zu verletzen. Die Diskussionen werfen auch ein Schlaglicht auf Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas.
Im Kampf gegen die Inflation setzt die Schweizerische Nationalbank vor allem auf eine Aufwertung des Frankens. Doch eine solche Politik hat enge Grenzen.
Der frühere CEO von Julius Bär und Pictet-Teilhaber wird nun Investor und Verwaltungsrat bei der EFG International. Dieser Bund könnte durchaus etwas länger halten.
Auch unter Ausklammerung der Energie steigen die Preise in der Euro-Zone deutlich stärker, als es der Europäischen Zentralbank lieb sein kann. Gleichzeitig stockt die Wirtschaft. Das bereitet den Währungshütern Kopfzerbrechen.
Laut einer Auswertung von gut 1300 Dossiers von ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz ähnelt die Verteilung der Berufshauptgruppen dem Schweizer Durchschnitt. Gut ein Drittel der Flüchtlinge sind Führungskräfte oder in akademischen Berufen tätig gewesen. Doch manche Betroffenen werden wohl Abstriche machen müssen.
Die Preise für Erdöl, Erdgas, Kohle und Strom sind in der vergangenen Zeit stark gestiegen. Dies erinnert an die Energieschocks vor 50 Jahren, die einschneidende Folgen hatten. Die derzeitigen Reaktionen mancher Regierungen sind aber kontraproduktiv.
Mit Alpenkräuter-Bonbons ist Ricola weltweit bekannt geworden. Innovativ zu bleiben und zu wachsen, ist aber gar nicht so einfach. Über die Gratwanderung einer Schweizer Traditionsmarke.
Der Ukraine-Krieg zwingt Deutschland, von billigem russischem Gas als «Brückentechnologie» Abschied zu nehmen. Dies hat Debatten über eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke provoziert.
In Deutschland, aber noch mehr in Gesamteuropa hält die Ladeinfrastruktur nicht Schritt mit der Marktentwicklung für die Elektromobilität. Dafür macht BMW-Chef Oliver Zipse unter andrem fehlende Genehmigungen verantwortlich. Sorgen bereitet ihm auch die einseitige Fokussierung auf batterieelektrische Fahrzeuge.
Ein radikales Energieembargo gegen Russland wäre möglich, das zeigt eine Studie – wenn auch eine arg umstrittene. Wer es unterlasse, tue das – zumindest als Bürger – auf dem Rücken der geschundenen ukrainischen Zivilbevölkerung, argumentiert Rüdiger Bachmann, einer der Autoren.
Im wohl wichtigsten Schweizer Wirtschaftsprozess der letzten Jahrzehnte werden die Hauptbeschuldigten Pierin Vincenz und Beat Stocker in Hauptpunkten verurteilt. Die Freiheitsstrafen von 3¾ und 4 Jahren sind überraschend hart. Vincenz’ Anwalt hat Berufung angekündigt.
In ihrem Podcast haben sich die Anwälte Duri Bonin und Gregor Münch seit Monaten intensiv mit dem Prozess gegen den früheren Raiffeisen-Chef befasst. Dass dabei keine Zeugen auftreten konnten, sehen sie kritisch.
Die Richter haben sich mehrheitlich den Argumenten der Anklage angeschlossen. Diese zeigt sich deutlich erleichtert. Alle Verurteilten haben Berufung angekündigt. Juristen kritisieren das Urteil.
Das Bezirksgericht hat die meisten Schadenersatzforderungen der Bank und der Kreditkartenfirma an ein Zivilverfahren verwiesen. Selbst wenn sie Erfolg haben, werden sie erst in einigen Jahren Geld sehen.
Der frühere Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wird zu 3,75 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das strenge Urteil wird allen eine Lehre sein, die sich um die Grundsätze guter Unternehmensführung foutieren.
Der Raiffeisen-Chef war lange der beliebteste Banker der Nation. Doch in der Finanzkrise verlor Pierin Vincenz die Bodenhaftung. Eine kurze Geschichte von Aufstieg und Fall.
Die Schweizer Grossbank durchlebt die turbulentesten Jahre seit der Finanzkrise. Strategische Fehler und Missmanagement sind offenkundig. Wie will sie die Wende schaffen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Der Krieg in der Ukraine wirkt nach Ansicht der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wegen der internationalen Verflechtungen wie Sand im Getriebe der Weltwirtschaft. Auch in der Schweiz werde er die Konjunktur bremsen, sagt der Nationalbankpräsident Thomas Jordan.
Die Finanzmarktaufsicht plant, den Handel mit Kryptowährungen stark einzuschränken. Damit würde auch die Technologieneutralität verletzt.
Ein überraschender Rückgang des BIP im ersten Quartal lässt die US-Wirtschaft schwächer aussehen, als diese angesichts der wohl immer noch robusten Binnennachfrage ist. Die Zentralbank muss das optimistische Grundvertrauen wahren.
Die Ära mit Urs Schaeppi an der Spitze des Telekomkonzerns endet versöhnlich. Die grösste Baustelle des Nachfolgers Christoph Aeschlimann befindet sich in der Schweiz.
Der Credit Suisse bleibt derzeit nichts erspart. Ein internationales Journalistennetzwerk wirft der Bank vor, sie habe über viele Jahre korrupte Autokraten, Kriegsverbrecher und andere Kriminelle als Kunden akzeptiert.
Daten von über 30 000 Bankkunden wurden der «Süddeutschen Zeitung» aus dem Inneren der Credit Suisse zugespielt. Für die Bank bedeutet das Datenleck einen massiven Vertrauensverlust. Womöglich hätte der Diebstahl von Kundendaten früher auffallen können.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat schon zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts vor Geldwäscherei-Risiken in Entwicklungs- und Schwellenländern gewarnt und ihre Aufsicht verschärft. 2018 beanstandete sie schwerwiegende Mängel bei der Credit Suisse. Doch Geldwäscherei ist nicht nur ein Problem der CS.
Ein Whistleblower hat Daten von mehr als 30 000 Kontoinhabern der Credit Suisse einem Recherchenetzwerk zugespielt. Die Geschäfte wirken anrüchig und dürften in der heutigen Gesetzeslage nicht mehr möglich sein. Die Banken sind aber gut beraten, auch über den gesetzlichen Rahmen hinaus Vorkehrungen zu treffen.
Die Schweizer Grossbank durchlebt die turbulentesten Jahre seit der Finanzkrise. Sie stolpert seit Jahren von einem Skandal in den nächsten. Strategische Fehler und Missmanagement werden offenkundig. Eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse.
Vor der Credit Suisse leistete sich António Horta-Osório bei Lloyds einen peinlichen Fehltritt. Dort reichte dem Verwaltungsrat eine Entschuldigung. Auf der Insel muss viel passieren, bis erfolgreiche Banker unhaltbar werden.
Die vergangenen Wochen haben eine Fülle von Uhren-Neuheiten hervorgebracht. Wir zeigen eine Auswahl der interessantesten Modelle.
Edle Uhren ziehen längst nicht mehr nur Fans und Sammler an, sondern auch diejenigen, die hoffen, das schnelle Geld zu machen – auf legale, aber auch auf illegale Art und Weise. Die Käufer sollten kritischer werden, aber auch die Hersteller sind in der Pflicht.
Patek Philippe nimmt dieses Jahr erstmals am Genfer Uhrensalon teil. Patron Thierry Stern erzählt, was für ihn anders ist als früher an der «Baselworld» und weshalb seine Belegschaft wächst, obschon er die Produktion nicht erhöht. Und er verrät, was ihn zur Lancierung der Tiffany-Nautilus bewogen hat.
Die Nachfrage nach hochwertigen mechanischen Uhren steigt und steigt. Die Hersteller nehmen das als Ansporn, noch besser und kreativer zu werden. Dies zeigt ein Augenschein an der Watches & Wonders Geneva, an der erstmals auch Rolex und andere Aussteller der früheren «Baselworld» teilnehmen.
Die Schweizer Uhrenindustrie hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Selbst im boomenden Luxussegment sind allerdings längst nicht alle Marken gleichermassen erfolgreich.
Schweizer Banken und Versicherungen finanzieren sich kaum über staatliche Subventionen, sondern müssen mit ihren Angeboten um Kunden kämpfen. Dennoch werden die Marktkräfte mancherorts unnötig eingeschränkt und behindert.
Der Föderalismus ist bloss ein Grund, warum die digitale Transformation der Behörden zu langsam vorankommt. Es geht auch um Verantwortungsbewusstsein und Mut zum nicht Perfekten.
Subventionen statt Preise, Detailplanung statt Markt und Vertrauen in den technologischen Fortschritt: Die staatliche Schweizer Klima- und Energiepolitik hat alle Zutaten, zu einem ineffizienten Subventionsmonster zu verkommen. Das muss nicht sein.
In der Theorie weiss man, wie ein gutes Steuersystem aussehen sollte: möglichst breite Steuerbasis, möglichst tiefe Steuersätze. In der Praxis marschiert die Politik in die Gegenrichtung. Steuerabzüge erlauben die Privilegierung von Gruppen unter Verschleierung der Kosten.
Die Ökonomenzunft hat sich in der Corona-Krise beherzt zu Wort gemeldet. Der Wirtschaftsgang, die Staatsschulden oder die Ungleichheit waren wichtige Themen. In der Rangliste der einflussreichsten Wirtschaftsexperten schafft es der Vizepräsident der Covid-Task-Force neu aufs Podest.
Insgesamt sind 40 Wirtschaftswissenschafter im Ranking vertreten. Neu zählen fünf Ökonominnen zu den einflussreichsten Fachpersonen in der Schweiz.
Russland macht mit der Drohung Ernst und stoppt die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Die EU-Kommission spricht von einem Erpressungsversuch. Was sind die Folgen? Wie geht es weiter? Die wichtigsten Antworten.
Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal steht Hanno Berger, der Architekt der umstrittenen Aktiengeschäfte, vor dem Landgericht Bonn. Ihm wird schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen. Worum geht es in diesem umstrittenen und komplizierten Fall?
Die wichtigsten Antworten zur Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande.
2002 erzielte Jean-Marie Le Pen 18 Prozent der Stimmen, nun holte Tochter Marine Le Pen 42 Prozent. Was steckt hinter dem Auftrieb für nationalistische Parteien in Frankreich? Lässt er sich wirtschaftlich erklären? Und was bedeutet das für Europa?
Präsident Biden wollte die Stimmen der weissen Arbeiterschicht mit hohen Staatsausgaben zurückgewinnen. Doch die steigenden Preise schmerzen nun genau diese Klientel. Wenn kein Wunder geschieht, droht den Demokraten eine Niederlage bei den Zwischenwahlen.
Mit seinem Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine attackiert Russland zugleich fundamentale Prinzipien der 1945 aus der Taufe gehobenen globalen Friedensordnung.
Der Grossmachtkonflikt zwischen den USA und China sowie der Ukraine-Krieg machen Japan für Deutschland plötzlich zu einem wichtigen Partner. Denn die beiden exportorientierten Mittelmächte teilen viele Interessen.
Indonesien will sich an der Spitze der G-20 als verantwortungsvolles Land präsentieren, das für ganz Südostasien spricht. Nun wächst jedoch die Gefahr, dass Jakarta zwischen die Fronten des Kriegs in der Ukraine gerät.