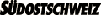
UBS-Chef Sergio Ermotti hat die Rettung seiner Bank während der Finanzkrise vor zehn Jahren verteidigt und die Schweizer Nationalbank (SNB) für ihre derzeitige Zinspolitik kritisiert. Die SNB habe im Falle einer erneuten Wirtschaftskrise kaum mehr Handlungsspielraum.
Der Verwaltungsrat der Academia Engiadina AG erneuert die Führung. Die Academia und CEO Matthias Steiger gehen künftig getrennte Wege.
An der KMU-Frauentagung in Chur haben sich über 130 Frauen aus der Wirtschaft ausgetauscht und Kontakte geknüpft. Im Zentrum standen aber auch ein lebenswichtiges Organ und ein bekannter Komiker.
Am Samstag findet im Engadin das erste Bergbierfestival Europas statt. Insgesamt können 25 verschiedene Biersorten von sechs Schweizer Brauereien degustiert werden. Das Spezielle: Alle teilnehmenden Brauereien produzieren über 1000 Meter über Meer.
Die «Rollbar»-Saison im Volksgarten geht am Wochenende zu Ende. Gastronom Fabian Noser und die Gemeinde Glarus sind mit dem Sommer mehr als zufrieden. Im nächsten Jahr soll das Beizli in den Volksgarten zurückkehren – wenn alles klappt.
Die Schweizer Firma On ist weltweit erfolgreich unterwegs. Die Idee zum leichten und trendigen Laufschuh kam den Gründern im Engadin. Bald will On auch einen Entwicklungsstandort im Engadin haben.
Dr. Richard glaubt an das Potenzial einer Fernbuslinie Graubünden–Zürich. Nun ist auch der Kanton mit an Bord.
Die Bündner Firma BC Tech will ihren Standort von Chur nach Domat/Ems verlagern. Das sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Der Churer Stadtpräsident Urs Marti findet dieses Vorhaben umstritten. Radio Südostschweiz hat mit Marti und mit Gegenpol Erich Kohler, Emser Gemeindepräsident, gesprochen.
Die brummende US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im Sommer ein wenig verlangsamt. Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,5 Prozent.
Die Aufwertung des Frankens und steigende Zinsen dürften der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im dritten Quartal einen Verlust einbrocken.
In Deutschland gibt es schon lange keine heimische Computer-Industrie mehr, aber bislang noch eine Fabrik. Auch diese soll nun bald Geschichte sein.
Die weltweite Weinerzeugung hat in diesem Jahr nach einem historischen Tief 2017 wieder kräftig um zwölf Prozent angezogen.
Um die Masten der geplanten Seilbahn über das Zürcher Seebecken im Grund des Zürichsees zu verankern, wollen die Ingenieure über 100 Riesenschrauben mit einer Länge von rund 24 Metern verwenden. Dazu fand nun eine Probebohrung statt.
Das italienische Luxusgüterunternehmen Bulgari erwartet für 2018 ein weiteres Rekordjahr. Wie Bulgari-Chef Jean-Christoph Babin im Gespräch mit AWP ausführte, sind vor allem die Länder China, USA und Russland dafür verantwortlich.
Trotz höherer Treibstoffkosten hat die British-Airways-Mutter IAG ihren Gewinn im dritten Quartal spürbar erhöht.
Der Luxusgüterkonzern Richemont geht eine globale strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Technologie-Riesen Alibaba ein.
Forschende der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW untersuchen, welche Auswirkungen Neonikotinoide auf das Gehirn von Bienen hat. Ihr Ziel ist, die Wirkung der Insektizide besser zu verstehen und Gesundheitsschäden möglichst früh zu erkennen.
Repower ist einen neuen Deal eingegangen. Im Bereich Elektromobilität arbeitet das Bündner Energieversorgungsunternehmen nun mit Jaguar zusammen.
Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat im dritten Quartal 2018 den Umsatz deutlich gesteigert. Das Betriebsergebnis legte überproportional zu und alle vier Segmente konnten den Absatz steigern.
Der Club der Milliardäre ist im vergangenen Jahr erneut grösser und vor allem enorm reicher geworden. Auch Schweizer Milliardäre mehrten ihren Reichtum. Im Vergleich zu den Wohlhabenden in China fällt ihr Vermögenszuwachs jedoch bescheiden aus.
Die angeschlagene Meier Tobler-Gruppe schliesst ihr Verlustgeschäft Keramikland. Betroffen davon sind 46 Arbeitsplätze an den Standorten in Huttwil, Cham, Chur und Zürich.
Vor 60 Jahren eröffnete in der schwedischen Provinz das erste Ikea-Möbelhaus. Heute ist es ein Museum und zeigt den wechselhaften Weg zum Weltkonzern. Der sieht sich im Jubiläumsjahr vielen Herausforderungen gegenüber und will digitaler werden.
Am Samstag kommt ein Wetterwechsel auf uns zu. Das Wanderwetter verabschiedet sich und der Winter meldet sich zu Wort. Doch wie viel Schnee wird es geben?
Die Grossbank UBS hat Gesicht und Stimme ihres Chefökonomen Daniel Kalt digitalisiert und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Dieser Avatar, der am Digitaltag in Chur vorgestellt wurde, soll als virtuelle Unterstützung dereinst den Kundenberatern zur Seite stehen.
Der Tarifverbund «Ostwind» baut das Angebot aus, erhöht aber die Preise nicht.
Die Foto-App Snapchat hat im Sommerquartal weiter Nutzer verloren. Die Firma rechnet auch nicht mit einer raschen Trendwende. In den drei Monaten bis Ende September sank die Zahl der täglich aktiven User um ein Prozent auf 188 Millionen.
Der weltgrösste Onlinehändler Amazon macht dank des boomenden Internethandels und starker Nachfrage nach seinen IT-Diensten weiterhin gute Geschäfte. Im dritten Quartal schoss der Nettogewinn von 256 Millionen im Vorjahr auf 2,9 Milliarden Dollar in die Höhe.
Googles Mutterkonzern Alphabet hat den Gewinn im Sommerquartal dank hoher Werbeeinnahmen und niedrigerer Steuern kräftig erhöht. In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Überschuss im Jahresvergleich von 6,7 Milliarden auf 9,2 Milliarden Dollar.
Unter dem Druck stark wachsender Konkurrenz durch private US-Firmen hat die Europäische Weltraumorganisation Esa sich für die kommenden Jahre neu ausgerichtet.
Der südkoreanische Elektronikhersteller LG schreibt im Geschäft mit Smartphones weiter rote Zahlen, hat allerdings den Verlust im dritten Quartal 2018 deutlich verringern können.

Washington versucht die chinesische Firma Jinhua zu bremsen. Deren Aktivitäten könnten die nationale Sicherheit der USA bedrohen.
Für seine Rolle in einem Geldwäscherei-Fall rund um Venezuelas Erdölgesellschaft muss ein Banker zehn Jahre ins Gefängnis. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Schwellenländergeschäfte gewisser Schweizer Banken.
Der britische Haushaltsplan für 2019 bringt ein Ende der Zurückhaltung. Die Haushaltskonsolidierung soll trotzdem gelingen – wenn nicht der Brexit dazwischenfunkt.
Der 45-jährige Matthias Krull erhält für seine Mitwirkung in einem Geldwäscherei-Ring die Maximalstrafe. Die US-Behörden untersuchen die Affäre um die venezolanischen Erdöl-Gelder weiter.
Mit der milliardenschweren Akquisition des Open-Source-Anbieters Red Hat versucht die IBM-Chefin Ginni Rometty, auch ihren Job zu sichern. Entscheidend wird sein, wie die unterschiedlichen Firmenkulturen miteinander harmonieren.
Schatzkanzler Hammond ist gezwungen, die Ausgabenwünsche seiner Chefin zu erfüllen. Daraus macht er eine Waffe gegen die innenpolitischen Gegner eines Brexit-Deals.
Mit der milliardenschweren Übernahme von Red Hat versucht der amerikanische Technologiekonzern IBM den Rückstand im florierenden Cloud-Computing-Geschäft wettzumachen. Es ist die letzte Chance für die bisher wenig glücklich operierende IBM-Chefin Ginni Rometty. Mit den Red-Hat-Leuten zieht eine neue Firmenkultur ein.
Was eine Strafleistung aufgrund des Vergleichs im Dieselskandal darstellt, könnte sich für die Wolfsburger als entscheidender Vorteil in Nordamerika entpuppen.
Das Computer-Urgestein IBM will sich mit seiner bisher grössten Übernahme ein grösseres Stück der IT-Ausgaben von Unternehmen sichern. IBM lässt sich den Kauf des Linux-Spezialisten Red Hat insgesamt 34 Milliarden Dollar kosten, wie die Unternehmen am Sonntag mitteilten.
Der Stuttgarter Konzern will nach den Worten von Vorstandschef Dieter Zetsche zwar keine Tesla-Aktien kaufen, könnte sich eine Zusammenarbeit mit dem US-Elektroautopionier aber vorstellen.
Ein kurzfristiger Streik am wichtigsten Flughafen Belgiens durchkreuzt die Pläne vieler Reisender – und das zum Ferienbeginn. Nach einem schnellen Ende des Konflikt sieht es nicht aus.
UBS-Chef Sergio Ermotti hat die Rettung seiner Bank während der Finanzkrise vor zehn Jahren verteidigt und die Schweizer Nationalbank (SNB) für ihre derzeitige Zinspolitik kritisiert. Die SNB habe im Falle einer erneuten Wirtschaftskrise kaum mehr Handlungsspielraum.
Mit dem neuen Grossflughafen will die Türkei zu einem der wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt werden. Das Mega-Projekt ist in vielerlei Hinsicht symbolhaft für die türkische Wirtschaftspolitik der letzten Jahre.
Die Kontrolle geht für den russischen Unternehmer Tinkoff über den Gewinn. Darum ärgert sich der Bankbesitzer auch nicht über entgangene Milliarden beim Fintech-Startup Revolut – sagt er zumindest.
Amerikas Wirtschaftswachstum hat sich unter Trump beschleunigt. Zu verdanken ist das vor allem höheren Staatsausgaben. Vergessen ist Trumps Versprechen, das wirtschaftliche Gewicht des Staates zu reduzieren.
Laut einer Studie gibt es weltweit 2158 Milliardäre. Das stärkste Wachstum ist dabei in China zu beobachten. Einiges spricht dafür, dass dieser Trend in den kommenden Jahren anhält.
In einem «New York Times»-Artikel wird Google beschuldigt, sexuelles Missverhalten von Mitarbeitern vertuscht zu haben. Nachdem ähnliche Vorfälle bei einer Reihe von Silicon-Valley-Firmen wie Uber aufgetaucht sind, hat nun auch Google seinen #MeToo-Moment – und schiesst erst einmal über das Ziel hinaus.
Hersteller italienischen Olivenöls streichen gerne hervor, dass ihr Produkt zu hundert Prozent aus Italien stamme. Doch den Grossteil der Arbeit bei der Ernte der Oliven leisten osteuropäische Wanderarbeiter.
Die Industriekonzerne ABB, Bucher und Huber + Suhner haben am Donnerstag allesamt erfreuliche Geschäftszahlen präsentiert. Doch angesichts der Handelsstreitigkeiten und anderer Unsicherheitsfaktoren wie des Brexit fragt sich, wie lange der Aufschwung noch anhält.
Südafrika muss neue Schulden aufnehmen, und Investoren sind davon zu überzeugen, dass endlich ein Neuanfang ansteht. Der neue Finanzminister hat das Zeug, das es für diese Herkulesaufgabe braucht.
Die Raffinerie vom Amuay war einst das Juwel der venezolanischen Erdölindustrie und der Stolz von Punto Fijo. Davon ist wenig übrig: Die Anlage ist am Verfallen, die Stadt versinkt im Abfall und ihre Bewohner in der Armut.
Im Silicon Valley stehen die wertvollsten Unternehmen unserer Zeit. Doch die Gemeinden, in denen Apple, Facebook und Google zu Hause sind, zahlen einen hohen Preis für den Erfolg der Firmen. Nun wagt eine Stadt den Aufstand.
Der Landesstreik in der Schweiz vor hundert Jahren wird meist als Kulminationspunkt einer stetigen Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage interpretiert. Ein Blick auf die Finanzmarktdaten jener Zeit legt aber den Schluss nahe, dass dieses Narrativ unzutreffend ist.
Die Geschichte des Tokioter Fischmarkts Tsukiji ist ein Spiegelbild des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs Japans nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt schliesst der traditionelle Handelsplatz die Tore.
Vergessen ist der Banken-Crash vom Oktober 2008 in Island zwar nicht, aber immerhin verdaut. Zehn Jahre nach der grossen Krise geht es der Nordatlantikinsel besser als je zuvor. Nun lautet die Aufgabe, drohende Ungleichgewichte früh genug zu erkennen.
Die US-Notenbank will 2%. Die neusten Daten zeigen exakt eine Inflationsrate von 2%. Die Teuerung in den USA entwickelt sich weiterhin verhalten.
Immigranten sind in der Schweiz besser ins Erwerbsleben integriert als etwa in Norwegen oder den USA. Dies zeigt eine neue Studie. Zwischen den Herkunftsländern bestehen jedoch erhebliche Unterschiede.
Vor zwei Jahren steckte die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft in einer schweren Krise. Nun ist sie auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und macht sich auf, neue Märkte zu erobern.
Die neuste Befragung von Arbeitgebern durch die Universität Zürich zeigt, wo Stellensuchende am ehesten Angebote finden.
Das reale BIP-Wachstum betrug jüngst 3,5 Prozent. Das ist zwar eine Verlangsamung gegenüber den 4,2 Prozent im zweiten Quartal, aber das Wachstum bleibt recht breit abgestützt.
Die Politik will Sozialdetektive, aber keine Steuerdetektive mit Observationsrechten. Die unterschiedliche Behandlung der beiden Deliktsarten hat ideologische und praktische Gründe.
China setzt auf Roboter. Sie sollen wegen des demografischen Wandels und des damit verbundenen Lohndrucks die Produktion verbilligen und auf ein neues Niveau heben. Am Wochenende hat sich ABB denn auch zum lukrativen chinesischen Markt bekannt. Der Industriekonzern investiert 150 Millionen Dollar in eine Fabrik in Schanghai.
Die russische Bankenkrise hat auch vor einem der traditionsreichsten russischen Versicherer nicht haltgemacht. Nun will der Versicherungsmanager Nikolaus Frei Rosgosstrakh zu altem Glanz zurückführen.
Das Bankensystem sei viel solider als noch vor zehn Jahren, betonen Bankvertreter und Regulatoren immer wieder. Das mag buchhalterisch gesehen stimmen, die Finanzmärkte beurteilen die Lage jedoch anders.
Richemont will seinen Internethandel in China ausweiten. Dafür geht das Unternehmen mit Alibaba ein Joint Venture ein. Die Hoffnungen sind gross.
In Deutschland könnte eine neue Grossbank entstehen. Getrieben von der Investorensuche der angeschlagenen Nord LB prüfen die Sparkassen, ob sie dem Familienmitglied durch eine Fusion mehrerer Institute zu Hilfe eilen.
Richemont will seinen Internethandel in China ausweiten. Dafür geht das Unternehmen mit Alibaba ein Joint Venture ein. Die Hoffnungen sind gross.
Am 6. November stehen in den USA Zwischenwahlen an. Die Republikaner könnten ihre Mehrheiten verlieren. Präsident Trump und seine Partei werden es mit ihrer wirtschaftspolitischen Agenda künftig noch schwerer haben.
Die Trump-Regierung versucht mit Hilfe von Zuckerbrot und Peitsche mit immer mehr Ländern zweiseitige Handelsabkommen abzuschliessen. Gegen China verhärten sich hingegen die Fronten. Der Handelskrieg erscheint als Kampf einer bestehenden Grossmacht mit einer aufstrebenden.
Seit dem Sturz Ghadhafis 2011 ist Libyen ein zerrüttetes Land. Im Dezember soll im nordafrikanischen Land gewählt werden. Wird dadurch der erdölreiche Staat stabilisiert?
Der frühere britische Premierminister John Major hält den EU-Austritt Grossbritanniens für einen Fehler. Europa muss sich auf die Hinterbeine stellen, um international eine bedeutende Rolle zu spielen.
China gewinnt auch an den Finanzmärkten massiv an Bedeutung. Es bleiben aber einige Herausforderungen, wie sich am diesjährigen Swiss International Finance Forum (SIFF) zeigt.
Investitionen auf soziale und ökologische Kriterien auszurichten, wird immer populärer. Viele versprechen sich davon höhere Renditen, wie am Podium des Swiss International Finance Forums deutlich wurde.
Brexit, China, Nachhaltigkeit – am Swiss International Finance Forum debattierten Experten aus der Finanzbranche und der Politik die brennendsten Fragen. Mit dabei waren unter anderen John Major, ehemaliger Premierminister Grossbritanniens und der Sicherheitsberater unter US-Präsident Obama, Ben Rhodes.
Was bedeutet Sustainable Finance für den Finanzplatz Schweiz? Welche Auswirkungen wird der Brexit haben und wie sieht die Zukunft der Banken in China aus? Am Swiss International Finance Forum debattieren Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik diese Fragen.
Vor zehn Jahren wurde die UBS von Bund und Nationalbank in einer beispiellosen Hilfsaktion gerettet. Nach dem Konkurs von Lehman Brothers wollte man verhindern, dass mit der Schweizer Grossbank dasselbe geschieht.
Vor 10 Jahren hat die Grossbank Staatshilfe in Anspruch nehmen müssen – und damit viel Vertrauen verloren. Dieses wieder aufzubauen, gelang erst nach einigen kommunikativen Fehlern.
Peter Kurer, der im Krisenjahr 2008 Verwaltungsratspräsident der UBS war, legt dar, wie die Grossbank an den Rand des Untergangs geriet, wie sie gerettet wurde und welche Fehler zu vermeiden gewesen wären.
Die Rettung der UBS hielt die Schweiz in Atem. Wie gerät ein Unternehmen in die Krise? Die UBS hat es vor einem Jahrzehnt vorexerziert. Eine Analyse.
Die UBS-Rettung vor zehn Jahren entpuppte sich als Erfolg. Ein Direktbeteiligter nennt vier Gründe, weshalb das riskante Vorhaben gelang.
Zehn Jahre nach ihrem Beinahe-Untergang ist die UBS wieder in der Spur. Aber die Zeiten, in denen sie zweistellige Milliardengewinne schrieb, sind endgültig vorbei.
Die NZZ hat ab dem 16. Oktober ausführlich und engagiert über die spektakuläre Rettung der UBS informiert. Hier die NZZ-Ausgaben der dramatischen Tage und die wichtigsten Artikel zu den Ereignissen.
An einem Freitagabend im September 2008 ruft der amerikanische Finanzminister Paulson die Chefs der US-Banken zusammen. Sie sollen Lehman Brothers retten. Ein Rückblick auf 48 dramatische Stunden.
Der Konkurs von Lehman Brothers 2008 riss die Märkte auf der ganzen Welt in die Tiefe. Manche fanden rasch zu alter Stärke zurück, andere brauchten Jahre – und die Aktienkurse der beiden Schweizer Grossbanken haben sich bis heute nicht erholt. Eine Übersicht.
Der Konkurs von Lehman Brothers 2008 brachte die globale Wirtschaftsordnung an den Rand des Kollapses. Heute ist das grundlegende Problem noch immer nicht gelöst.
Der Notenbankchef Thomas Jordan liefert einen raren Einblick in die Krisenpolitik der Schweiz nach dem Kollaps von Lehman Brothers. Im Interview mit der NZZ rechtfertigt er die UBS-Rettung: «Der Verlauf der Geschichte gab uns recht.»
In den USA entstand über Jahrzehnte ein toxischer Cocktail, der letztlich das gesamte Finanzsystem an den Rand des Abgrunds brachte. Finanzinstitute, Regulatoren, Politiker und Konsumenten – sie alle versagten im Kollektiv.
Die Bankenregulierung wurde in den vergangenen zehn Jahren enorm ausgebaut. Ob damit das Finanzsystem stabiler wurde, ist aber alles andere als klar.
Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession wird nicht grösser, nur weil ein Aufschwung schon sehr lange anhält. Ökonomische Expansionen, das zeigt die Geschichte, sterben nicht an Altersschwäche.
Bedeutet eine geringere Kapitaldeckung eine Gefahr für die Finanzstabilität? Ökonomen untersuchten Daten seit 1870. Ihre Ergebnisse sind überraschend. Der grösste Feind ist oft nicht die Regulierung, sondern eine mangelhafte Führung.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Die NZZ hat im Umfeld des Untergangs der Bank Lehman Brothers intensiv über den Fall und die dramatischen Probleme der US-Banken informiert. Hier die NZZ-Ausgaben der dramatischen Tage und die wichtigsten Artikel zu den Ereignissen.
Der Bankrott der Investmentbank Lehman ist das Symbol der Finanzkrise. Die Folgen für die Wirtschaft waren dramatisch.
Am 15. September 2008 bricht die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers zusammen – es war der Anfang einer globalen Finanzkrise.
Seit dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers verkünden manche das Ende des Liberalismus, andere setzen mit allen Mitteln auf strukturerhaltende Schadensbegrenzung. Beides ist falsch.
Zur Bewältigung der Finanzkrise haben viele Staaten fast ihr ganzes Pulver verschossen. Um geld- und fiskalpolitisch wieder Spielraum zu gewinnen, drängen sich Reformen auf. Was zu tun wäre, skizziert die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Die Finanzkrise vor zehn Jahren kam für die meisten Wirtschaftswissenschafter völlig überraschend. Das bringt der Zunft bis heute viel Spott ein. Doch viele Kritiker machen sich die Sache zu einfach.
Mit Guy Lachappelle, dem Chef der Basler Kantonalbank, steht ein Kandidat für das Raiffeisen-Präsidium bereit. Doch bei der Entsorgung der Altlasten gibt es noch viel zu tun. Worum geht es konkret? Ein Überblick.
Die Bankengruppe profitiert in personell stürmischen Zeiten von einem widerstandsfähigen Geschäftsmodell.
Der bisherige Chef der Basler Kantonalbank soll das Aufsichtsgremium der drittgrössten Bank im Land leiten. Gleichzeitig stehen vier weitere neue Mitglieder zur Wahl.
Mit der Nomination von Guy Lachappelle setzt der Verwaltungsrat von Raiffeisen ein deutliches Zeichen. Die Raiffeisenbanken wollen in St. Gallen mitreden, die Zeit der Solokünstler ist vorbei.
Guy Lachappelle musste bei der Basler Kantonalbank (BKB) einige Baustellen aufräumen. Imagemässig steht das Institut heute nun wieder besser da als noch vor einigen Jahren. Kann er als Präsident auch bei Raiffeisen etwas bewegen?
Pascal Gantenbein, Vizepräsident der Raiffeisen-Gruppe, führt im Gespräch aus, warum gerade Guy Lachappelle als neuer Präsident nominiert wurde. Eine ganze Reihe von Fähigkeiten habe den Ausschlag gegeben.
Der Staatsbetrieb hat alle Voraussetzungen, um das Hypothekengeschäft zu forcieren, sollte das Kreditvergabeverbot wegfallen. Gerade im jetzigen Umfeld könnte das gravierende Folgen haben.
Der Bundesrat will die Fesseln der Postfinance lockern. Er lässt eine Vorlage ausarbeiten, die es der viertgrössten Schweizer Bank erlaubt, Kredite und Hypotheken zu vergeben. Gleichzeitig will er das Aktionariat öffnen. Er sieht aber keine Privatisierung vor.
Der Bund präsentiert eine unausgegorene Lösung, um die vielfältigen Probleme des Finanzdienstleisters Postfinance zu lösen. Es gilt, den gordischen Knoten zu zerschlagen.
Mit den Postreformen privatisierte Berlin einst die Bundespost, aus der auch die Postbank hervorging. Doch bis heute fehlt es der früheren Staatsbank, die nun der Deutschen Bank gehört, an Effizienz.
Postfinance soll laut dem Bundesrat künftig Hypotheken und Kredite vergeben dürfen. Bis das Finanzinstitut zu einer privatisierten normalen Bank würde, dürften in jedem Fall noch Jahre vergehen.
Der Bundesrat will Postfinance neue Geschäftsfelder erlauben und private Aktionäre ins Boot holen. Doch die Pläne stossen bei den Parteien praktisch durchgehend auf Ablehnung.
Der Bundesrat möchte das Hypothekar- und Kreditverbot für Postfinance lockern und sie im Gegenzug teilprivatisieren. Fünf Fragen und Antworten dazu, was das heisst und bedeutet.
Nicht nur in der Akademie, sondern auch in der Öffentlichkeit: Das NZZ-Ranking zeigt, welche Ökonomen in der Schweiz wahrgenommen werden.
Aus der Schweiz haben nur zwei Ökonomen den Sprung über die Grenze geschafft: Ernst Fehr und Bruno S. Frey. Der Zürcher Verhaltensökonom Fehr setzt sich dafür gleich in beiden Ländern an die Spitze.
Insgesamt haben 38 Wirtschaftswissenschafter die Aufnahme in das Ranking geschafft. Bei den Institutionen baut die erstplatzierte Universität Zürich ihren Vorsprung weiter aus.
Die polnische Kleinstadt Plock beherbergt das grösste Unternehmen des Landes. Aber die Orlen-Raffinerie macht nicht nur glücklich. Politik und Umweltprobleme sorgen für dicke Luft.
Schwedens nördlichste Stadt lebt seit über hundert Jahren von der Mine. Doch allmählich bedroht der Untertagbau die Stabilität des Bodens unter dem Stadtzentrum.
Vor mehr als hundert Jahren errichtete Milton Hershey eine Schokoladefabrik im ländlichen Pennsylvania. Für die Arbeiter baute er Wohnhäuser, eine Bank, Schulen und Parkanlagen. Noch heute hält er indirekt seine Hand schützend über die Stadt.
Die Entwicklung der St. Galler Gemeinde Uzwil ist eng mit dem Familienunternehmen Bühler verknüpft. Zwischen öffentlicher Hand und dem Weltkonzern stimmt offenbar die Balance – auch wenn der Erfolg Verkehrsprobleme mit sich bringt.
Wer kennt sie nicht, die opulenten Tafelservices und Einzelstücke mit den gekreuzten Schwertern aus Meissener Porzellan? Doch die letzten Jahre waren miserabel. Mit Millionen vom Staat nimmt die Traditionsfirma einen neuen Anlauf.
Kaum eine Schweizer Gemeinde ist derart abhängig von einem einzelnen Unternehmen wie das Oberwalliser Städtchen Visp. Die Chemiegruppe Lonza ist der dominierende Arbeitgeber und Steuerzahler.
Die Digitalisierung pflügt die Wirtschaft um. Die Rede ist von der zweiten oder gar vierten industriellen Revolution. Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Revolution jedoch als jahrzehntelanger Strukturwandel.
In der Demokratie obliegen wichtige Entscheide der parlamentarischen Kontrolle. Das gilt jedoch nicht für Zentralbanken, die grosse Autonomie geniessen, um den Auftrag der Geldwertstabilität zu erfüllen. Doch der lauter werdende Vorwurf des Machtmissbrauchs könnte ihre Position gefährden.
Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius bleiben. Schweizer Durchschnittstemperaturen haben diese Grenze bereits überschritten, trotzdem steigt der Verbrauch fossiler Energien weiter. Dabei gäbe es eine einfache Antwort.
Wie lässt sich der Absatz von Produkten ankurbeln? Die Marketingspezialisten suchen immer wieder nach Mitteln und Wegen, wie sie die Konsumenten mehr zu Käufen animieren können. Zuweilen erscheinen ihre Methoden unheimlich. Dabei sind die einfachsten Rezepte die wirksamsten.
Ein Luzerner macht Karriere beim «Internetkonzern des 19. Jahrhunderts».
Amy Goldstein erzählt in «Janesville» die Geschichte von den Menschen in der Kleinstadt Janesville im Gliedstaat Wisconsin und wie sie damit umgehen, dass die Autofabrik in ihrem Ort die Tore schliesst.
Fast jede Schweizer Firma muss sich ans neue Datenschutzgesetz der EU halten. Dem Einzelnen verschafft es mehr Transparenz. Machen es die Firmen geschickt, resultiert daraus mehr als nur ein bürokratischer Mehraufwand.
Seit Freitagmorgen gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Obwohl das so überraschend wie Weihnachten daherkommt, haben einige Website-Betreiber ihren Dienst (temporär) dichtmachen müssen.
Adrian Lobsiger ist seit bald zwei Jahren ein pragmatischer eidgenössischer Datenschützer. Dass die Schweiz der EU ab diesem Freitag beim Datenschutz hinterherhinkt, macht ihm Sorge.
Die Facebook-Affäre um Cambridge Analytica und die EU-Datenschutzverordnung haben das Thema Datensicherheit in den Vordergrund gerückt. Doch damit haben sie einen anderen Aspekt verdrängt.
Lange haben die Amerikaner einen laschen Umgang mit ihren Daten hingenommen. Fälle wie Cambridge Analytica haben das Thema Datenschutz jedoch in die Öffentlichkeit gebracht. Das neue Datenschutzgesetz der EU allerdings nur bedingt als Vorbild.
Grosszügige Ausgaben bei tieferen Einnahmen, so lautet die Zusammenfassung des Haushaltsentwurfs der italienischen Regierung aus Links- und Rechtspopulisten. Kann Brüssel das Euro-Land in die Schranken weisen?
Hauptbetroffen vom US-Handelsverbot gegenüber Iran sind europäische Firmen. Die Europäer wollen Trump die Stirn bieten und die in Iran tätigen Firmen schützen. Unterstützung bekommen sie dabei von der Uno.
Die Strafzölle, die US-Präsident Trump gegen die wichtigsten Handelspartner verhängt, haben einen Konflikt mit unabsehbaren Folgen ausgelöst. Nach Gegenmassnahmen der betroffenen Länder schaltet Trump jeweils eine Eskalationsstufe höher. Wie geht es weiter?
Am Montag, 29. Oktober (dem türkischen Nationalfeiertag), wird in Istanbul der neue Grossflughafen eröffnet. Das Projekt ist einer der gigantischen Infrastrukturbauten, mit denen sich der seit 2003 regierende Recep Tayyip Erdogan Denkmäler setzt.
Paul Allen gründete am 4. April 1975 zusammen mit Bill Gates das Softwareunternehmen Microsoft. Am Montag ist er 65-jährig seinem Krebsleiden erlegen.
Die Aktienkurse an der Wall Street sind in den letzten zwei Tagen gesunken. Damit reagiert New York erstmals seit langem auch mit einem Hüsteln, wenn andere Weltfinanzmärkte Grippe haben.
Die Währung fällt in den Keller, das Geld ist nichts mehr wert, der Schwarzmarkt blüht – eine Hyperinflation stürzt ganze Volkswirtschaften ins Elend. Besonders hart waren die Abstürze in Europa in der Zeit der beiden Weltkriege.
Banken werden auch künftig ihren Kunden Zugang zu beiden Welten bieten müssen – zur Welt der Maschinen und zu jener der Berater aus Fleisch und Blut.
Bernhard Hodler ist seit einem knappen Jahr oberster operativer Chef von Julius Bär. Er will die Privatbank, die in den vergangenen Monaten wiederholt für negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit Geldwäschereifällen gesorgt hat, auf wenige Kernmärkte fokussieren und fit für die digitale Zukunft machen.
Gerade in einer zunehmend digitalen Welt lohnt sich in der Vermögensverwaltung die Rückbesinnung auf «traditionelle» Werte – etwa auf die Service-Kultur. Dabei können sich Banken durchaus eine Scheibe von der Hotelbranche abschneiden.
Digitalisierung und Compliance gehen gut zusammen. Digitale Prozesse verringern die Fehleranfälligkeit und reduzieren die Kosten. Aber sie kommen nicht ohne menschliche Kontrolle aus.
Die Digitalisierung prägt und verändert die Gesellschaft. Sie verändert die Erwartungen und das Verhalten der Kunden und zwingt die Banken, ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten und die Prozesse zu optimieren.
Die Automatisierung in der Finanzbranche schreitet voran. Besonders für Vermögen unterhalb der Millionengrenze werden digitalisierte Angebote an Bedeutung gewinnen. Doch was unterscheidet gute von schlechten Robotern?
Auch in Zeiten der Digitalisierung sind Menschen unersetzlich. Roboter und künstliche Intelligenz sind nicht mehr als Werkzeuge, die den Menschen stärker und wettbewerbsfähiger machen, denn letztlich sind sie nur Nachfolger des Faustkeils.
Je mehr digitale Bankdienstleistungen vermögende Kunden nutzen, desto mehr persönliche Beratung beanspruchen sie.
Die Datenmengen nehmen exponentiell zu. Gerade in der Vermögensverwaltung, in der Informationen seit je ein entscheidender Erfolgsfaktor sind, spielen sie eine wichtige Rolle.
Die Digitalisierung ist intransparent und bereitet mittelgrossen Banken Mühe. Um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, gilt es, Stossrichtungen festzulegen.
Migros, Coop oder die Mobiliar: Bedeutende Schweizer Konzerne sind als Genossenschaften organisiert. Kaum ein Firmengründer entscheidet sich heute aber noch für diese Gesellschaftsform. Warum ist das so?
Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und was es bei der Investition in Nebenwerte zu beachten gilt.
Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und was es beim Kauf dieses Wertpapiers zu beachten gilt.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Nach den Amerikanern interessieren sich auch die französischen Strafrichter für die früheren Aufgaben von Raoul Weil. Doch der ehemalige Chef der UBS-Vermögensverwaltung will nicht den geringsten Hinweis auf illegale Geschäfte der Bank in Frankreich gehabt haben.
Das Damoklesschwert drohender Fahrverbote für alte Dieselautos in Deutschland bleibt laut Experten noch Jahre bestehen. Derweil warnt die EU-Kommission die Hersteller vor dem Export eingetauschter Fahrzeuge.
Die Börse und der Wechselkurs in Russland sind derzeit stark von den Spekulationen über neue Sanktionen aus den USA abhängig. Es gibt aber auch Profiteure.























