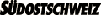
Lange war darüber spekuliert worden, jetzt ist es klar: Die beruflichen Wege von Raiffeisen und Nadja Ceregato, der Ehefrau von Pierin Vincenz, trennen sich. Zu den laufenden Verhandlungen mit ihrer Chefjuristin gibt die Bankengruppe keine Auskunft.
Ex-Rennfahrer und Airline-Gründer Niki Lauda verteidigt seinen Verkauf der Laudamotion an die irische Billigfluglinie Ryanair. Dass er nur ein Strohmann für die Iren gewesen sein könnte, dementierte Lauda.
Für Axpo-Präsident Thomas Sieber ist eine Strommarktöffnung in der Schweiz eine Voraussetzung für ein EU-Stromabkommen. Auch Schweizer Stromkundinnen und Kunden sollten künftig ihren Versorger selber bestimmen können.
Der erste Nonstop-Direktflug von Australien nach Grossbritannien ist am Sonntagmorgen nach über 17 Stunden am Flughafen London Heathrow angekommen. An Bord des «historischen» Flugs mit einem Boeing-787-Dreamliner waren über 200 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder.
Die Geschäfte der Sedruner Bäckerei «La Conditoria» laufen gut. So gut, dass jetzt eine neue Produktionsstätte gebaut werden soll.
EU-Justizkommissarin Vera Jourova fordert vom US-Konzern Facebook nach dem Datenskandal genauere Auskünfte. «Ich verlange von Facebook weitere Klarstellungen, etwa inwieweit europäische Nutzer betroffen sind», sagte sie der «Bild am Sonntag».
Das «Rocket Team» der ETH Lausanne konnte am Samstag seine Rakete im Testlauf nicht abschiessen - weil einige Teile defekt waren. Die Forscher wollen den Prototypen am Spaceport America Cup vorstellen, dem weltweit grössten Studentenwettbewerb für Raketenstarts.
Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt ist am Samstagmorgen aus dem Hafen von Saint-Nazaire in Westfrankreich ausgelaufen. Hunderte kamen, um zu sehen, wie die «Symphony of the Seas» die Anker lichtete und auf ihre Jungfernfahrt ging.
Apple-Chef Tim Cook setzt im Handelsstreit zwischen den USA und China auf moderate Kräfte. Er hoffe, dass sich die «kühlen Köpfe» durchsetzten, sagte der Manager am Samstag am Rande einer Konferenz in Peking.
Die Versammlung der Wasserkorporation Kaltbrunn lief wie nach Drehbuch: Die Anwesenden winkten alle Anträge des Verwaltungsrates durch. Dies vor allem, weil die Korporation 2017 gut gearbeitet hat.
Schnee perfekt. Wetter gut. Unterhaltung musikalisch: Für Wintersportler wird das lange Osterwochenende schon fast kitschig schön. Einige Tipps rund ums Frühlingsskifahren.
Hamilton-CEO Andreas Wieland öffnet für die «Südostschweiz am Wochenende» erstmals die Türen des Neubaus in Domat/Ems. Dort arbeiten bereits 50 Mitarbeiter.
Planer Mark Rutishauser ist sich sicher: Mit «Bellavista» wird Mollis aufgewertet. Er stellt aber auch fest, dass der Widerstand gegen verdichtetes Bauen auf dem Land grösser ist. Der vierte Teil der Serie zum verdichteten Bauen.
Der Kies- und Betonindustrie geht es gut. Damit das auch in Zukunft so bleibt, braucht es stetige Veränderungen. So wird die Führung des Branchenverbandes bis nächstes Jahr neu organisiert.
Hightech-Konzern Hamilton schafft in Domat/Ems deutlich mehr Stellen als erwartet.
Das Sterben der Hedgefonds-Branche geht weiter. Im letzten Jahr hätten weltweit 784 Hedgefonds dichtgemacht, nur 735 gingen an den Start. Gründe für die Schliessungen sind schlechte Wertentwicklungen und Schwierigkeiten, Kapital aufzunehmen.
Sensation in der Tiefseeforschung: Zum ersten Mal überhaupt haben Tierfilmer einen lebenden, selbstleuchtenden Fächerflossen-Seeteufel beobachtet und vor die Kamera bekommen.
Die USA verschärfen den wirtschaftlichen Konflikt mit China und ziehen wegen Diebstahls geistigen Eigentums vor die Welthandelsorganisation (WTO).
Forscher der ETH Zürich fabrizieren selbstfaltende Origami-Strukturen mit dem 3D-Drucker. Das Prinzip haben sie dem Ohrwurm abgeschaut, einem Tier mit rekordverdächtigen Flügeln.
Die Agrischa macht Landwirtschaft erlebbar. Die neunte Ausgabe findet vom 6. bis 8. April auf der Oberen Au in Chur statt. Dort zeigen Bündner Bäuerinnen und Bauern, was sie können und produzieren. Eine Sonderschau widmet sich dem Boden.
Der im Herzen von Davos gelegene Arkadenplatz soll nicht mehr als triste Autoabstellfläche genutzt werden, sondern Menschen als Begegnungszone dienen. Das Projekt sieht auch einen Mehrzweckraum mit Kino vor.
Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam erhält für 2017 einen Lohn von 9,7 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte er 10,24 Millionen Franken erhalten.
Ein einziger Glarner Wahlkandidat setzte auf gezielte Internetwerbung. Wir wollten wissen, was dies bringt. Vier Fragen an Mirko Blümel, Online Campaign & Product Manager bei Somedia Promotion.
Nach der Abfuhr für den einzelnen Strassenabschnitt St. Gallerstrasse/Feldlistrasse an der Urne haben der Kanton und die Stadt Rapperswil-Jona ihr Gesamtkonzept für die Ost-West-Achse der Stadt präsentiert. Im Frühjahr 2019 könnte es zur Abstimmung über das Projekt kommen.
Am 31. März wird die Steuererklärung fällig - sofern keine Fristverlängerung beantragt wurde. Damit Euch beim Ausfüllen keine Fehler unterlaufen und keine möglichen Abzüge durch die Lappen gehen, lassen wir Eure Fragen von Spezialisten beantworten.
In fast genau drei Jahren will die europäische Weltraumorganisation ESA wieder einen Rover auf den Mars schicken. Etwas weniger hoch hinaus, aber früher, will die Kopter Group AG mit ihrem Projekt. Beide waren das Hauptthema am gestrigen Bodensee Aerospace Meeting (BAM) in Opfikon-Glattbrugg.
Die Kopter Group AG will «senkrecht nach oben». Fünf Fragen an Christian Zehnder, Leiter Standortpromotion im Kanton Glarus.
Im Kampf gegen die Inflation will die venezolanische Regierung die Landeswährung Bolivar neu bewerten. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Donnerstag ein neues Zahlungsmittel an, für das drei Nullen gestrichen werden sollen.
US-Präsident Donald Trump hat Ausnahmen von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium für die EU und andere Handelspartner definitiv gebilligt. Das Weisse Haus teilte mit, die Strafzölle auf Importe der Metalle seien für mehrere Länder bis zum 1. Mai ausgesetzt.
Der Online-Speicherdienst Dropbox strebt zu seinem Börsengang am Freitag eine höhere Bewertung an als bisher vorgesehen. Diese soll bei über 9 statt 7 Milliarden Dollar liegen.

Der Euro-Raum benötigt laut der IMF-Chefin Christine Lagarde einen gemeinsamen «Schlechtwetterfonds». Sie greift mit dem Vorschlag in ein politisches Wespennest.
Die Altersvorsorge und die Schuldenbremse bieten im Länderexamen des Internationalen Währungsfonds Reibungsflächen für die Schweizer Politik
Das Land erkauft sich Ausnahmen von den neuen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium mit Konzessionen anderswo.
Der Verkauf der Industriesparte von Alpiq und der Fokus auf die Stromproduktion stossen bei Energiepolitikern auf Verständnis. Doch ziehen diese sogleich rote Linien: Es dürfe nicht dazu kommen, dass der Staat einspringen müsse.
Bouygues ist ein langfristig denkender Player im Baugeschäft. Durch die Übernahme erhofft man sich eine stärkere Verankerung in der Schweiz.
Uber mag global die bekanntere Marke sein, doch in Südostasien konnte die Firma gegen den aufstrebenden Fahrdienst Grab wenig ausrichten. Jetzt ziehen sich die Amerikaner auf die Rolle als Juniorpartner zurück.
Der geplatzte Börsengang der Gategroup spiegelt fehlendes Vertrauen in die chinesische HNA Group. Der Liquiditätsengpass des undurchsichtigen Finanzkonstrukts spitzt sich zu.
Die Strategie, mit der Kreierung der Alpiq einen bedeutenden europäischen Versorger zu formen, ist gescheitert. Die Rumpf-Alpiq hat nur eine Zukunft, wenn die Strompreise in Europa wieder steigen.
Mit der Veräusserung der Industriesparte saniert sich die defizitäre Energiegruppe Alpiq. 7650 der 9200 Mitarbeiter wechseln zum französischen Baukonzern Bouygues.
Radikaler Schritt bei der Energiefirma Alpiq: Fünf von sechs Mitarbeitern sollen in einen anderen Konzern wechseln. Die wichtigsten Antworten zum Verkauf der Gebäude- und Industrietechnik.
Die Investoren haben dem Airline-Caterer Gategroup beim geplanten Börsengang die Gefolgschaft verweigert. Zurück bleiben viele Verlierer.
Esswaren und Getränke aus natürlichen Zutaten sind in. Diesem Trend kann sich auch die Branche der Aromenhersteller nicht entziehen. Die Genfer Givaudan-Gruppe greift für die französische Firma Naturex tief in die Tasche.
Der norwegische Markt ist für den Elektroautohersteller eine Goldgrube, doch bei der Logistik ist die Schmerzgrenze für Tesla überschritten.
Die Genfer Givaudan-Gruppe holt zu einer grossen Übernahme in Frankreich aus. Kommt der Kauf der auf die Extraktion von Pflanzen spezialisierten Firma Naturex wie geplant zustande, wird sie dafür fast 1,3 Mrd. € auslegen.
Ein gutes Dutzend führende Versicherer haben das Blockchain-Startup-Unternehmen B3i in Zürich aus der Taufe gehoben. Regierungsrätin Carmen Walker Späh zeigt sich über den Standortentscheid erfreut.
In Geschäftsberichten von Firmen steht das Entscheidende nicht immer an erster Stelle. Das war auch dieses Jahr nicht anders. Testen Sie im Quiz Ihre Buchhalter-Spürnase.
Bangladesh feiert die Aussicht, in absehbarer Zukunft nicht mehr zu den rückständigsten Ländern der Erde gezählt zu werden. Der unrühmliche Status hatte aber auch seine Vorteile.
Das Technologie-Unternehmen Dropbox ist beim Börsenstart an der Wall Street von den Aktionären bejubelt worden. Die Investoren würden gerne mehr solcher «Einhörner» aus dem Silicon Valley in New York sehen.
Der US-Pharmariese Pfizer hat noch keinen Käufer für seine nicht verschreibungspflichtigen Medikamente gefunden. Überraschend ist dies nicht.
Das Tessiner Unternehmen Interroll hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem wichtigen Anbieter logistischer Hardware-Komponenten entwickelt. Ein Grossauftrag von Amazon ist ein weiterer Meilenstein.
Auch Schweizer Konzerne wie Roche, Novartis oder Sulzer haben ihre Tätigkeitsbereiche deutlich enger gefasst als früher. Den umgekehrten Weg beschreitet die Industriegruppe Metall Zug. Lorbeeren wird sie sich damit kaum holen.
Viele Brexit-Befürworter sind empört. Aus der Farbe der Brexiteers wird «French Navy».
Die Verantwortlichen des staatlichen Rüstungs- und Industriekonzerns Ruag sind gefordert, die jüngsten Vorwürfe entschlossen und lückenlos aufzuklären. Zudem gilt es, den Konzern endlich wieder in ruhigere Gewässer zu führen.
Regierungschef Orban dürfte auf einen klaren Wahlsieg in Ungarn zusteuern. Aber der Vorwurf, sein Umfeld sei auf unsaubere Weise zu wirtschaftlichem Erfolg gekommen, sorgt für Gegenwind. Tatsächlich gibt es viele Hinweise auf Vetternwirtschaft.
Die EU hat am Freitag eine dauerhafte statt nur eine vorläufige Ausnahme von den neuen US-Zöllen auf Stahl und Aluminium gefordert. Die von Präsident Trump gesetzte Frist für Gespräche hält sie für viel zu kurz.
Die Reaktion Pekings auf Trumps Massnahmen fällt zwar inhaltlich relativ moderat aus, doch der Ton hat sich verändert.
Die EU-27 billigen die provisorische Brexit-Übergangslösung und verabschieden Leitlinien zu den künftigen Beziehungen mit London: Konkret bieten sie Grossbritannien ein Freihandelsabkommen an – ohne speziellen Zugang für den Finanzsektor.
Die geplante Reform der Firmensteuern bringt laut groben Schätzungen per saldo keine Mehrbelastungen für die KMU. Doch in einigen Kantonen sieht das Bild ganz anders aus.
Die EU hat kühl auf ihre temporäre Ausnahme von den neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium reagiert. Sie hält diese nach wie vor für ungerechtfertigt und ärgert sich über die neue Frist.
Die Ausgangslage ist grotesk: Während Washington einen Handelskrieg heraufbeschwört, mimt Peking den Verfechter einer liberalen Welthandelsordnung. Das wird China aber nicht davon abhalten, selbst aktiv zu werden.
Klimawandel und Luftverschmutzung sind derzeit die besten Verkaufsargumente an den Metallmärkten. Der Hype um Batterien und Elektrofahrzeuge lässt Bergbaufirmen und Händler auf Preissteigerungen hoffen. Die grüne Einfärbung ist aber nicht unproblematisch.
Ein mexikanisches Jungunternehmen hat einen Fahrdienst von Frauen für Frauen gegründet. Es trifft damit einen Nerv der Zeit.
Eine Untersuchungskommission bringt systemische Probleme im Bankenwesen an den Tag. Noch ist unklar, was das für die Branche bedeuten wird.
Georges Kern hat die Schaffhauser Uhrenfirma IWC gross gemacht und leitet seit einigen Monaten die Marke Breitling. Im Interview erklärt er, warum er seine neue Rolle als Glücksfall sieht, weshalb er Breitling ein neues Image verpasst und warum auch seine Mitarbeiter ein vitales Interesse daran haben, der Marke zum Erfolg zu verhelfen.
Der Hersteller und Händler von Landmaschinen und Spezialfahrzeugen überzeugt im operativen Geschäft. Für Investoren ist jedoch vor allem der hohe Bestand an flüssigen Mitteln interessant.
Grosse Messen mit internationaler Ausstrahlung sind für die Schweizer Uhrenindustrie wichtig. Aber selbst die Aussteller sind sich einig, dass die Baselworld vieles anders machen muss, wenn sie überleben will. Und die Zeit drängt.
Fünfzehn Jahre nach dem Verkauf durch Roche werden in Sisseln noch immer Vitamine für den Weltmarkt produziert. Das Werk, das mittlerweile dem niederländischen Chemiekonzern DSM gehört, ist in seiner Branche trotz harter chinesischer Konkurrenz das weltgrösste geblieben.
Amy Goldstein erzählt in «Janesville» die Geschichte von den Menschen in der Kleinstadt Janesville im Gliedstaat Wisconsin und wie sie damit umgehen, dass die Autofabrik in ihrem Ort die Tore schliesst.
Bei Kirchenvätern hat das Finanzsystem keinen guten Ruf. Machen Christen, die ein sittliches Leben führen wollen, daher besser einen Bogen um die Welt der Geldwirtschaft?
Braucht ein Finanzsystem in einer digitalen Welt überhaupt noch Banken? Oder wäre dieses System nicht stabiler ohne traditionelle Geldhäuser? Ein neues Buch gibt Auskunft.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Der übermässige Konsum von Softgetränken schadet der Gesundheit. Aus diesem Grund rät die Weltgesundheitsorganisation zu einer Zuckersteuer.
Der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin ist im Moment riesig. Doch wie funktioniert die Technologie, die hinter den Bitcoin-Transaktionen steckt?
Infizieren, ausspionieren und erpressen, Cyberkriminalität hat viele Facetten. In den letzten Jahren haben dabei die Risiken für Schweizer Unternehmen massiv zugenommen.
Ein Mitarbeiter der Ruag soll auf eigene Faust Waffen verkauft und dabei Bestechungsgelder eingesetzt haben. Der Fall wird genau vor der Bilanzmedienkonferenz der Schweizer Firma bekannt und wirft ein Schlaglicht auf deren Rüstungsgeschäft.
Die Luzerner Kantonalbank schult ihre Schalterangestellten zu einer Art Gastgeber um. Auch hier macht Übung den Meister.
Stationen der Ikea-Erfolgsgeschichte.
Ein grosser Teil der afrikanischen Milliardäre stammt aus Süd- und Nordafrika. Aber es gibt auch Superreiche aus Tansania, Simbabwe oder Nigeria – und zwei Frauen.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Zur Abschwächung des Frankens muss die Schweizerische Nationalbank weniger tief in die Tasche greifen. Der Trend sinkender Devisenmarktinterventionen hat sich auch 2017 fortgesetzt.
Die sehr lockere Geldpolitik in der Schweiz steht in wachsendem Kontrast zur boomenden Konjunktur. Doch den Währungshütern sind die Hände gebunden.
Vor drei Jahren hat die Schweizerische Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben. Seither wandte sie einen dreistelligen Milliardenbetrag auf, um den Franken zu schwächen. Die Kritik, sie hätte die Kursuntergrenze besser aufrechterhalten, verkennt, was das bedeutet hätte.























