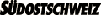
Die Alterssiedlung Bodmer in Chur wird vergrössert. Am Mittwochmorgen ist der Spatenstich zum Bau des «Haus am Mühlbach» erfolgt, das neben 30 Alterswohnungen auch den Kindergarten Bodmer beherbergen soll.
Die IG Metall hat ihre Drohung wahr gemacht und lässt ihre Mitglieder in den ersten von geplant mehr als 250 Betrieben der Metall- und Elektroindustrie für 24 Stunden in Warnstreik treten.
Die Zahl der Arbeitslosen in der Europäischen Union hat sich im vergangenen Jahr um gut zwei Millionen verringert. Wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, waren im Dezember noch 17,96 Millionen Männer und Frauen ohne Job.
Der Graubündnerische Baumeisterverband ist gemäss eigenen Angaben entlastet. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission habe die Einstellung des Verfahrens gegen den GBV beantragt. Ein Entscheid soll bald gefällt werden.
Die Julius Bär Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 die Gewinnzahlen klar verbessert und hat die verwalteten Vermögen nicht zuletzt dank guter Neugeldzuflüsse deutlich gesteigert.
Das Hochalpine Institut Ftan ist in die Cambridge Community aufgenommen worden. Das nützt aber nicht nur der Schule selbst.
Die Politische Gemeinde Schänis hat im Kampf gegen die Schliessung der Poststelle alle Mittel ausgeschöpft. Die Eidgenössische Postkommission Postcom hat den Entscheid der Post geprüft und keine Mängel festgestellt. Der Schänner Gemeindepräsident Herbert Küng wartet nun auf die entscheidende Mitteilung vom Gelben Riesen.
Spezialeinheiten von Zoll und Polizei sind im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am Dienstagmorgen gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen.
Der Schweizer Aussenhandel hat im Dezember letzten Jahres nochmals kräftig zugelegt, vor allem auf bereinigter Basis. Entsprechend ergab sich sowohl für den Berichtsmonat wie auch für das Gesamtjahr 2017 erneut ein hoher Exportüberschuss.
Die deutschsprachigen Tageszeitungen von Somedia «Südostschweiz» und «Bündner Tagblatt» werden künftig in Graubünden von einer zusammengeführten Redaktion betreut. Dadurch werden Synergien geschaffen und Kosten gespart. Die Planungsarbeiten beginnen in diesen Tagen, die Umsetzung erfolgt auf Mitte April dieses Jahres.
Jetzt gibt der Kanton mit dem geplanten Innovationszentrum Gas. Derzeit läuft die Standortsuche. Eines sorgt aber für Unmut: Die Gemeinde, die den Park will, muss in die Tasche greifen.
Der weltgrösste Uhrenhersteller Swatch hat dank der wieder erwachten Kauflust im Fernen Osten im letzten Jahr zum Wachstum zurückgefunden. Der Umsatz stieg 2017 zu konstanten Wechselkursen um 5,8 Prozent auf 7,99 Milliarden Franken, wie Swatch am Dienstag mitteilte.
Im Streit über die Kontrolle des Luftraumes zwischen China und Taiwan haben chinesische Airlines 176 zusätzlich geplante Flüge zum chinesischen Neujahrsfest nach Taiwan gestrichen. Dies berichtete Chinas Staatsfernsehen am Dienstag.
Der deutsche Softwareriese SAP stärkt sich in den USA mit der Übernahme des Cloud-Spezialanbieters Callidus Software. Der Kaufpreis liege bei 36 Dollar je Aktie, gab das deutsche Unternehmen am Dienstag bekannt.
Streitigkeiten sind eine unangenehme Sache. Noch schlimmer ist es, wenn sie vor Gericht ausgetragen werden. Der Anwalt und Mediator Philipp Langlotz will zeigen, dass sich Konflikte auch anders lösen lassen.
Eine schlechte Nachricht jagt die andere: Der «Bahnhof» Linthal, der «Sternen» Netstal, «Ochsen», «Linde» und ab morgen das «Buffet» in Glarus: geschlossen. Jetzt trifft es auch noch das «City».
Die grösste Bank der USA, JPMorgan Chase, sorgt für Kontinuität auf dem Chefposten. Der 61-jährige Konzernchef Jamie Dimon werde für weitere fünf Jahre im Amt bleiben, gab die Bank am Montag nach US-Börsenschluss bekannt.
Wegen immer höherer Temperaturen steigen die meisten Gebirgspflanzen in die Höhe. Sie tun dies an der unteren Grenze ihrer Verbreitung schneller als an der oberen Grenze.
Die ehemalige Papierproduzentin Cham Paper Group kann eine Immobilienfirma werden. Die Aktionäre haben am Montag an einer ausserordentlichen Generalversammlung sämtliche dafür notwendigen Anträge mit deutlicher Mehrheit angenommen.
Die Post hat am Montag im Hinblick auf die kommenden Olympischen Winterspiele in Südkorea eine Sondermarke herausgegeben. Als Sujet dient die Skisprungschanze von Pyeongchang.
Der Traumstrand aus «The Beach» muss sich erholen. Der Schaden an seinen Korallen, ein beliebtes Ziel bei Schnorchlern, hat ein kritisches Ausmass erreicht.
Bei Billigflieger Easyjet sollen bald deutlich mehr Frauen im Cockpit sitzen. Im Jahr 2020 solle mindestens jeder Fünfte neu eingestellte Pilot weiblich sein, kündigte Unternehmenschef Johan Lundgren am Montag an.
Es läuft rund bei Playmobil. Geschäftstreiber waren 2017 vor allem lukrative Lizenzgeschäfte aus Filmen und die Digitalisierung. Für die Zukunft hat sich das deutsche Unternehmen hohe Ziele gesteckt.
Nachdem Tierversuche beim Test von Dieselabgasen bekannt geworden sind, fordert die deutsche Regierung Aufklärung. Kritik äusserten auch das deutsche Verkehrsministeriumund Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.
Der Stahlkonzern Schmolz+Bickenbach (S+B) übernimmt verschiedene Standorte und Anlagen der französischen Asco Industries. Das zuständige Gericht in Frankreich hat ihm am Montag den Zuschlag erteilt zur Übernahme.
Die Schweizer KMU sind gesund und haben 2017 den Aufwärtstrend bei Fusionen und Übernahmen bestätigt. Auch für dieses Jahr rechnet das Beratungsunternehmen Deloitte mit einem klaren Anstieg der Transaktionen.
Das Zuger Schraubenhandels- und Logistikunternehmen Bossard wird ab nächstem Jahr vom Familienmitglied Daniel Bossard geleitet. Er löst dann David Dean ab, der 15 Jahre lange Bossard-Chef war.
Mia Engiadina feiert das fünfjährige Bestehen. Aus einer visionären Idee wurde in kürzester Zeit eine Plattform für zukunftsweisende Projekte.
Das Verkehrschaos während des WEF-Jahrestreffens war ein grosses Ärgernis. WEF-Direktor Alois Zwinggi wünscht sich darum eine verkehrsfreie Davoser Promenade. Gegen Wucherpreise für Ferienwohnungen will er juristisch vorgehen.
Die Davoser nervten sich am WEF über endlose Staus, die WEF-Oberen über Abzocker-Methoden im Dorf. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Die indische Regierung stellt im Jahreshaushalt ein riesiges Krankenversicherungsprogramm für die ärmsten Bevölkerungsschichten in Aussicht. Kapitalgewinne werden wieder besteuert.
Mercedes-Benz hat dank blendenden Geschäften in China ein Rekordjahr hinter sich. Es gibt eine rekordhohe Dividende und eine Mitarbeiterprämie. Doch diese Erfolge werden überschattet von den jüngsten Nachrichten zum Dieselskandal. Das ärgert Daimler-Chef Zetsche.
2017 war für die US-Tourismusbranche kein gutes Jahr. Auch die Schweizer bleiben weg. Nur von einem Trump-Effekt zu sprechen, wäre aber nicht fair.
Der Ölpreis hat sich in den vergangenen beiden Jahren mehr als verdoppelt. Derzeit rechnen manche Fachleute mit weiteren Preissteigerungen, obwohl die amerikanischen Anbieter Rekordmengen fördern.
Nach Ansicht des Roche-Konzernchefs Severin Schwan wäre eine Annahme der SVP-«Begrenzungsinitiative» für den Schweizer Wirtschaftsstandort «Gift». Die Einschätzung verdient ernst genommen zu werden, denn ohne Personenfreizügigkeit mit der EU stünden Arbeitsplätze vor allem in der Forschung auf dem Spiel.
Die Bank hat rund um die brasilianischen Korruptionsfälle Petrobras und Odebrecht zu wenig getan, um problematische Transaktionen und Geschäftsbeziehungen abzuklären. Die Finma zieht den unrechtmässig erzielten Millionengewinn ein.
Chinas grösster Onlinehändler boomt, wenn man den neusten Zahlen glaubt. Das Unternehmen von Jack Ma ist on- und offline auf dem Vormarsch.
Das Ergebnis des Basler Pharmakonzerns ist im vergangenen Jahr durch Wertminderungen deutlich beeinträchtigt worden. 2018 droht wachsender Druck wegen Nachahmerprodukten.
Vier Jahre nach dem Maidan-Umsturz hat sich Enttäuschung über den Reformfortschritt in der Ukraine breitgemacht. Der wichtigste ausländische Berater der ukrainischen Politik vertritt aber eine andere Sicht.
Der irisch-schweizerische Bäckereikonzern verkauft die Tochterfirma Cloverhill Bakery in Chicago. Damit wird eine unglückliche Geschichte zu einem Ende gebracht.
Das Kantonsinstitut hat 2017 in allen Geschäftsbereichen mehr verdient und den höchsten Gewinn seiner Geschichte ausgewiesen. Die Aktionäre kommen in den Genuss einer höheren Dividende.
Die Konkurrenz, die den grossen Roche-Krebsmittel durch Nachahmerprodukte erwächst, sorgt für einen Dämpfer beim Wachstum. Zudem musste das Unternehmen einen grösseren Abschreiber verbuchen.
Die Digitalwährung Bitcoin wird derzeit heftig durchgeschüttelt – und zeigt alle Anzeichen einer Spekulationsblase, der Luft entweichen kann. Was steckt dahinter, und wie funktionieren Bitcoins überhaupt? Die wichtigsten Antworten.
Um sich über Entwicklungen der Unternehmenswelt ins Bild zu setzen, braucht es nicht unbedingt eine Bezahlzeitung; es gibt genügend andere Informationsquellen, die unentgeltlich sind. Die Frage stellt sich deshalb: Warum berichten Zeitungen überhaupt noch über Firmen?
Es gibt unterschiedliche Gründe, mit dem «Plan B» zur Unternehmensbesteuerung unzufrieden zu sein. Doch gerade deswegen bringt ein erneutes Aufschnüren nichts. Er ist ein Kompromiss, und die Zeit drängt.
In den USA ist die Arbeitslosenquote nicht einmal halb so hoch wie im Euro-Raum. Ist deswegen der amerikanische Arbeitsmarkt in einer besseren Verfassung als jener Europas? Nicht zwingend.
Das Davoser WEF hinterlässt in Grabers Betrieb Spuren. Sein Chef, der den Anlass besucht hat, möchte die Betriebskultur und die Welt verändern.
Der Siemens-Chef Joe Kaeser hat seine Firma gelobt, weil sie mehr Leute beschäftige als Apple, Google, Microsoft und Facebook zusammen. Doch Beschäftigung ist nicht die Raison d'être einer Firma, sondern ein erfreulicher Nebeneffekt.
Der langjährige Verwaltungsratspräsident des Basler Chemiekonzerns Lonza, Rolf Soiron, kann mit ruhigem Gewissen in den Ruhestand treten. Lonza hat die Profitabilität in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Die Chancen für eine weitere Leistungssteigerung stehen gut.
Postfinance und andere Finanzdienstleister erneuern ihre IT. Für Bankangestellte bedeutet das eine Zeitenwende.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Der Bundesrat beschliesst Eckwerte zur Neuauflage der Unternehmenssteuerreform.
Im Januar ist die jährliche Inflation der Euro-Zone auf 1,3% gesunken. Damit bleibt sie weiterhin tiefer, als der EZB lieb ist. Um genau einen Prozentpunkt zurückgegangen ist im letzten Jahr die Arbeitslosenquote.
Präsident Macron setzt sich als grossartiger Reformer für Frankreich und Europa in Szene. Laut einem führenden Forschungsinstitut hat sich aber die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs weiter verschlechtert.
Sechs Jahre lang stand Thomas Wieser als Chef der Eurogroup Working Group im Zentrum der Krisenbewältigung der Euro-Zone. Zum Abschied aus Brüssel zieht er im Interview Bilanz.
Das Bruttoinlandprodukt der Euro-Zone ist im Schlussquartal 2017 um 0,6% gestiegen. Das ganze letzte Jahr war für den Euro-Raum und die EU das beste seit einer Dekade.
US-Unternehmen haben sich in China auch schon willkommener gefühlt. Eine Befragung der amerikanischen Handelskammer in China zeigt jedoch auch: Washington muss sich bewusst sein, wie wichtig der wachsende chinesische Markt für die Firmen aus dem eigenen Land ist.
In einigen Entwicklungsländern machen die Geldüberweisungen von Migranten über einen Fünftel der Wirtschaftskraft aus. Dennoch wurde die Diaspora in der Entwicklungspolitik lange vernachlässigt. Das beginnt sich zu ändern, auch in der Schweiz.
Neue Regeln für Banken sollen das Finanzsystem sicherer machen. Doch die Regeln können für Kreditinstitute teuer werden, weswegen sie dagegen lobbyieren. Dabei sind einige grosse Risiken noch gar nicht adressiert.
Das weltgrösste soziale Netzwerk hat glänzende Zahlen für das per Dezember abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Allerdings verbrachten die Nutzer pro Tag 50 Millionen Stunden weniger Zeit in dem sozialen Netzwerk als noch im dritten Quartal.
Nach VW hat nun auch Daimler einen Mitarbeiter beurlaubt. Er war im Vorstand der Forschungsvereinigung, die die umstrittenen Studien bewilligt hatte. Die Anleger reagierten bisher ziemlich gefasst.
Im Zuge der letztjährigen Übernahme des amerikanischen Kapselherstellers Capsugel hat sich die Nettoverschuldung des Basler Chemiekonzerns Lonza mehr als verdoppelt. Doch die Basler sind auch stark gewachsen – nicht nur dank dem akquirierten Geschäft.
Die Bank hat im vergangenen Jahr besser verdient, neue Gelder angezogen und die verwalteten Vermögen, die Basis künftiger Erträge, ausgeweitet. Aber die Überraschungsmomente fehlen.
VW-Chef Matthias Müller bezeichnet die Versuche mit Affen als zutiefst beschämend. Bekannt wurde auch, dass im parlamentarischen Untersuchungsausschuss Experten über Tierversuche sprachen. Ein Kadermann wurde inzwischen beurlaubt.
Das aufgrund der «No Billag»-Initiative unter Druck stehende Medienhaus SRG ist bereit, ihre Anteile an der Werbevermarktungsfirma Admeira zu veräussern. Das sagte Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina in einer Fernsehsendung. Offen bleibt, wer die Anteile kaufen würde.
Gewerbebetriebe nutzen die digitalen Kommunikationskanäle äusserst selten, obwohl sich auch mit kleinen Budgets gezielte Werbekampagnen realisieren lassen.
Der Besuch des US-Präsidenten in Davos hat die Schweiz in einen zweiwöchigen Ausnahmezustand versetzt. Wie konnte das geschehen? Das grosse Trump-Theater in vier Akten.
Donald Trump hat seinen Auftritt in Davos gut genutzt, und die ans WEF gereiste Elite zeigte sich ungewöhnlich optimistisch. Doch gerade Europa bleibt akut gefordert und sollte nicht in Überschwang verfallen.
Der Auftritt des amerikanischen Präsidenten am WEF in der Schweiz ist ohne Eklat abgelaufen. Trump machte vor allem Reklame für sein Land und lud internationale Konzerne ein, nun in den USA zu investieren.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fordert einen Beitrag der Bauern bei den Freihandelsgesprächen. In Sachen Verständigung mit der EU solle sich die Schweiz nicht unter Druck setzen lassen, meint er.
US-Präsident Donald Trump hat das diesjährige WEF geprägt wie kein anderer. Mit einer grossen Lobrede auf sich und sein Land sorgte er für das Schlussbouquet. Laut den Behörden soll das WEF künftig nicht noch grösser werden.
US-Präsident Donald Trump hat seine mit Spannung erwartete Rede gehalten. Dabei erfand er das Rad nicht neu, zeigte sich aber beim Thema Freihandel offener als auch schon – und natürlich durfte eine Spitze gegen die «Fake-News» nicht fehlen.
Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat der US-Präsident Donald Trump eine Lobrede auf sich selbst und seine Regierung gehalten. Bei der Handelspolitik hörten sich seine Äusserungen etwas besänftigend an.
Am nächsten Mittwoch macht der Bundesrat seine europapolitische Auslegeordnung. Bundesrat Ueli Maurer erklärt seine Haltung.
Donald Trump hat am WEF in Davos Bundespräsident Alain Berset getroffen und seine Abschlussrede gehalten. Darin verteidigte er seine Politik des «America First» und lobte sein eigenes Wirken sowie die Verdienste seiner Regierung.
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Seit der Bankenkrise 2007/08 wird an den Spielregeln des Finanzmarktes geschraubt. Das Dickicht an Regeln wird immer undurchdringlicher. Es ist höchste Zeit, die Regulierung endlich klar auszurichten.
Banker wie Axel Weber und Aufseher wie Elke König warnen vor neuer Regulierungs-Kleinstaaterei. Bail-in-Kapital bei Bankenpleiten ist oft noch in den falschen Händen. Die Folgen der Krise dauern an.
Rückblick auf die Vorboten der Finanzkrise vor zehn Jahren – die Subprime-Kredite sind zwar gezähmt, doch drohen andere Gefahren.
Es hat lang gedauert, bis sich die Finanzwirtschaft einigermassen aus dem Loch herausgearbeitet hat, in das sie 2007 gefallen war. Es gibt indes Kollateralschäden, die weiter Anlass zur Sorge geben.
Wer sind die Personen, die von Offshore-Geschäften profitieren? In den «Paradise Papers» finden sich Namen von Politikern wie Gerhard Schröder und Juan Manuel Santos bis hin zu Künstlern wie Bono, Shakira und Madonna – eine Übersicht.
Mit den «Paradise Papers» rücken die Steuerpraktiken internationaler Konzerne erneut in den Fokus. Globalen Firmen stehen viel mehr Wege offen als lokalen Konkurrenten, um Steuern zu optimieren.
Die vertraulichen Dokumente haben fragwürdige Investments der beiden königlichen Familienmitglieder aufgedeckt.
Als der Bundesrat 2016 die Kandidatur Monika Ribars zur SBB-Verwaltungsratspräsidentin guthiess, war ihm ihr Mandat in Angola nicht bekannt. Ribar war indes vor Antritt ihres neuen Amtes aus der Firma ausgetreten.
Wie ein Schweiz-Angolaner mit Milliarden jongliert und ein Mittelsmann verdächtig tiefe Bergbaulizenzen aushandelte.
Wie so vieles können auch Offshore-Geschäfte für kriminelle oder fragwürdige Geschäfte missbraucht werden. Sie gehören aber zu einer globalen Wirtschaft. Manchmal sind sie Ausdruck von Missständen, kaum je deren Ursache.
Wer steckt sein Geld in Offshore-Konstrukte? War das legal? Und was steht im jüngsten Datenleck zur Schweiz? Ein Überblick.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zieht sich zwar den Mantel der Wissenschaft über. Sein Buch zur Europäischen Währungsunion verkommt dennoch zum Pamphlet.
Das Verhältnis zwischen den Baslern und ihrer Industrie war und ist nicht immer ein einfaches. Ein neues Buch zeichnet die Verflechtung von Stadt und Chemie nach.
Der Euro–Krise liegen nicht nur divergierende Interessen zugrunde. Zwischen Nord und Süd klafft auch ein ideengeschichtlicher Graben. Ein neues Buch nennt die Gründe dafür.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Guy de Picciotto, Chef der Privatbank UBP, glaubt, dass die Finanzbranche ein neues Kapitel aufschlagen könne. Nach einer Phase der Transformation biete sich die Chance, alte Stärken auszuspielen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft mit ausländischen Vermögen ist keine Goldgrube mehr. Dennoch setzt der Schweizer Finanzplatz auf dieses Geschäft. Vier Experten erklären, wo Banken noch wachsen können und welches die grössten Herausforderungen sind.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Nur jene Banken werden gestärkt daraus hervorgehen, die Althergebrachtes hinterfragen, Innovatives wagen.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigennützig ist. Doch uns sind auch andere Motivationen zu eigen.
Zahlreiche Grosskonzerne und mittelgrosse Firmen schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Vor zehn Jahren als Methode zur Stressbewältigung eingeführt, soll sie heute noch mehr können.
Oft ist es nicht die Arbeit, die Menschen ausbrennen lässt, sondern die Vernachlässigung ihrer Ressourcen. Dem Wichtigsten schenken sie meistens am wenigsten Beachtung: ihrem Bedürfnis nach Bindung.
Die Neurowissenschaften haben bewiesen: Meditation ändert nicht nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch seine Morphologie.
Bosch, Beiersdorf und Axpo flankieren mit Achtsamkeitstraining der Führungskräfte ihre Transformation in agile Unternehmen. Nach anfänglicher Skepsis zieht die Mehrheit der Geschulten positive Bilanz.
Eine Unternehmenskultur ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, das man sich erst leisten sollte, wenn der Laden gut läuft. Achtsamkeit kann vor Fehlentwicklungen schützen.
«Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika alleine», sagte US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum in Davos. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden.
Infizieren, ausspionieren und erpressen, Cyberkriminalität hat viele Facetten. In den letzten Jahren haben dabei die Risiken für Schweizer Unternehmen massiv zugenommen.
Der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin ist im Moment riesig. Doch wie funktioniert die Technologie, die hinter den Bitcoin-Transaktionen steckt?
Das Weltwirtschaftsforum ist in den letzten 48 Jahren zum wichtigsten Treffpunkt für Wirtschaft und Politik geworden. Ein Blick zurück.
Vom Dienstag bis Freitag (23.-26. Januar) trifft sich die politische und wirtschaftliche Elite am Weltwirtschaftsforum in Davos. Das diesjährige WEF steht unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt».
Auch dieses Jahr hat sich wieder viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft am Davoser Weltwirtschaftsforum angemeldet.
Die Armee und zahlreiche Helfer bereiten die Stadt Davos für das Weltwirtschaftsforum vom 23. bis 26. Januar vor.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Soll die Staatenwelt das Nebeneinander von zwei AIA-Systemen für alle Zukunft akzeptieren? Das darf nicht sein. Die USA sollten den OECD-Standard ebenfalls anwenden.
Die kommende Steuertransparenz inspirierte viele Sünder zu Selbstanzeigen. 2017 haben sich schätzungsweise 35 000 Steuersünder selbst gemeldet.
Die Urheber der Bankgeheimnis-Initiative sehen ihr Hauptziel erreicht und ersparen sich eine Volksabstimmung, die sie nur schwer hätten gewinnen können.























