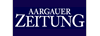
Nach der Aufhebung der meisten Sanktionen gegen den Iran will die US-Regierung ausländischen Banken offenbar Geschäfte mit der Islamischen Republik erleichtern. Anwälte und Experten sagten am Montag, die Behörden wollten die Institute rückversichern.
Griechenland wird vorerst nur 1,1 Milliarden Euro an Hilfsgeldern von seinen Euro-Partnern erhalten. Darauf verständigten sich die Euro-Finanzminister am Montag an ihrem Treffen in Luxemburg. Die verbleibenden 1,7 Milliarden Euro sollen später folgen.
Aktionäre des Kurznachrichtendienstes Twitter ergreifen die Flucht: Nach einem Medienbericht, wonach sich sämtliche Kaufinteressenten zurückgezogen haben sollen, brachen die Titel an der Wall Street um bis zu 15 Prozent ein.
Bei Samsung nimmt das Desaster um brennende Akkus beim neuen Smartphone Galaxy Note 7 immer verheerendere Ausmasse an. Der Weltmarktführer hat laut einem Insider die Produktion des Geräts zunächst komplett gestoppt.
Die SBB schliesst per Ende 2016 die beiden 1. Klass-Lounges in den Bahnhöfen Zürich und Genf. Wegen der immer kürzer werdenden Anschlusszeiten im Bahnverkehr und der vielfältigen Verpflegungsmöglichkeiten an den beiden Bahnhöfen nutzen zu wenig Passagiere das Angebot.
Vertragskonstruktionen für Top-Manager sind komplex. Dazu forschen die in den USA lehrenden Wissenschaftler Hart und Holmström. Nun bekommen sie dafür den Wirtschafts-Nobelpreis.
Den besten Platz am Pool oder Strand mit einem Tüechli zu besetzen – diese angebliche Eigenheit deutscher Touristen nimmt die Swiss in ihrem neuesten PR-Clip aufs Korn. Sehr zum Ärger der Deutschen in der Schweiz.
Die Bahn 2000-Neubaustrecke der SBB zwischen Mattstetten BE und Rothrist AG ist am kommenden Wochenende wegen Unterhaltsarbeiten teilweise gesperrt. Reisende zwischen Zürich und Bern müssen längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.
Die Konzernverantwortungsinitiative dürfte an die Urne kommen: Die Initianten haben sie am Montag mit rund 120'000 gültigen Unterschriften eingereicht. Das Begehren will Schweizer Konzerne verpflichten, Menschenrechte und Umwelt auch im Ausland zu respektieren.
Die Schweizer Seidenproduktion feiert nach 100-jährigem Unterbruch ein Comeback. Dieses Jahr werden 25 Kilogramm Rohseide hergestellt und weiterverarbeitet, in absehbarer Zeit sollen es bis 100 Kilogramm jährlich sein.
Im September hat sich die Arbeitslosenquote nicht verändert. Sie verharrte bei 3,2 Prozent, verglichen mit dem August. Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich um 183 Personen. Insgesamt waren 142'675 Personen als arbeitslos gemeldet.
Der weltgrösste Aroma- und Riechstoffhersteller Givaudan ist in den ersten neun Monaten nochmals gewachsen. Der Umsatz hat um 6,7 Prozent auf 3,518 Milliarden Franken zugelegt. Beide Segmente haben zum Wachstum beigetragen.
Samsung setzt offenbar die Produktion seines problembehafteten Smartphones Galaxy Note 7 aus, nach Berichten in den USA über Brände auch bei ausgetauschten Geräten. Inzwischen wurden vier Fälle bekannt, in denen ein Austauschgerät in Flammen aufgegangen sein soll.
Ab dem 1. Januar 2017 entscheidet das sogenannte Swissness-Gesetz, ab ein Produkt als schweizerisch beworben werden darf.Die Anpassung an das Gesetz läuft auch im Aargau – mit variierenden Vorzeichen.
Die im Mai angekündigte Restrukturierung sei umgesetzt, sagt der CEO der Neuen Aargauer Bank im Gespräch mit der az. Nun muss Roland Herrmann die Bank in die digitale Zukunft führen. Wie die aussehen wird, wisse er nicht, sagt er.
In geheimen Reglementen steht, wie viel Geld ein Krankenversicherter bringt.
Die vorübergehend eingestellte grösste ungarische Oppositionszeitung "Nepszabadsag" soll nach den Worten ihres Chefredaktors verkauft werden. Die Zeitung solle jedoch "unabhängig bleiben", egal wer der neue Eigentümer werde.
China hat die von der EU verhängten Strafzölle auf Stahlerzeugnisse als "unfair und unzumutbar" kritisiert. Sein fünfprozentiger Anteil am europäischen Stahlmarkt würde der Industrie in der Europäischen Union "nicht ernsthaft schaden".
Beim Kürbis-Wettwiegen hat ein belgischer Züchter den Weltrekord gebrochen. Der Kürbis von Matthias Willemijns habe 1190,5 Kilo gewogen und damit den bisherigen Höchstwert um fast 150 Kilo übertroffen.
Nach tagelangen Problemen wegen zahlreicher Krankmeldungen von Piloten und Kabinenpersonal hat der Ferienflieger Tuifly nach eigenen Angaben am Sonntag wieder seinen normalen Flugbetrieb aufnehmen können.

Nach Reformfortschritten ist der Weg für die Auszahlung weiterer Hilfskredite an Griechenland weitgehend frei. Den Schuldenruf des IMF versucht die Euro-Gruppe angestrengt zu überhören.
Was soll den Bonus des CEO bestimmen, was den Lohn des Angestellten? Soll der Staat Spitäler bauen oder privatisieren? Oliver Hart und Bengt Holmström erhalten für ihre Forschung den Wirtschaftspreis.
Die chinesischen Metropolen Peking und Schanghai unternehmen viel, um die populären Online-Fahrdienstanbieter wie Didi in die Schranken zu weisen. Die traditionellen Taxiunternehmen dürfte es freuen.
Der koreanische Handyhersteller Samsung muss einen weiteren Rückschlag einstecken und stoppt seine Produktion des Galaxy-Note-7-Handys. Doch die Probleme gehen über das Modell hinaus.
Die weltweite Nachfrage nach Primärenergie pro Kopf dürfte vor 2030 ihren Höhepunkt überschritten haben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Weltenergierats. Langfristig werde Kohle ihre starke Position einbüssen.
Am 27. November 2016 findet die Volksabstimmung zur Atomausstiegsinitiative statt. Im Kern geht es um die Zukunft der Atomenergie in der Schweiz. Wie gut wissen Sie darüber Bescheid? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!
Erstmals seit fünf Jahren hat sich die Arbeitslosigkeit im September leicht verringert. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung kann aber noch nicht von einer Trendwende am Schweizer Arbeitsmarkt gesprochen werden.
Laut Informationen des «Spiegel» haben die deutschen Bundesländer beschlossen, ab 2030 keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zuzulassen. Nun soll ein europaweites Verbot durchgesetzt werden.
Vergangene Woche machte Samsungs Smartphone damit Schlagzeilen, dass es unvermittelt in Flammen aufgehen kann. Nun reagiert der südkoreanische Konzern entschieden.
Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister SIX prüft, ob er eine gemeinsame Backoffice-Plattform für Schweizer Banken ins Leben rufen will. Dadurch liessen sich Skaleneffekte ausnutzen.
Der Automobilhersteller Ford hat vergangene Woche seine Produktion in Australien eingestellt. Andernorts fluoriert die Autoindustrie jedoch weiterhin.
Der Franken-Schock ist zwar noch nicht überwunden. Dennoch darf man auf eine baldige Trendwende am Schweizer Arbeitsmarkt hoffen. Sorgen bereitet allerdings ein anderes Thema.
Die Kostensteigerung im Gesundheitswesen liegt Jahr für Jahr weit über der durchschnittlichen Teuerung. Fehlender Wettbewerb und mangelhafte Kostenkontrollen kommen die Versicherten teuer zu stehen.
Deutschland hat nicht erst seit der Finanzkrise Mühe mit seiner Bankenbranche. Das Bankwesen behagt vielen Deutschen nicht, da darf auch einmal der Minister draufhauen.
Man kann in den USA den Steuerbehörden einen Verlust von 900 Mio. $ deklarieren, ohne ihn selbst zu tragen. Experten mutmassen, wie Donald Trump dies schaffte.
Snapchat, der vor gerade fünf Jahren gegründete Instant-Messaging-Dienst, bereitet für einen Gang auf das Börsenparkett vor und peilt eine Bewertung von bis zu 25 Mrd. $ an.
Frankreichs Premierminister Manuel Valls hat Deutschland aufgefordert, die eigene Wirtschaft zugunsten von Europa anzukurbeln und die Schuldenaufnahme durch die EU selber zuzulassen.
Immer mehr europäische Staaten führen Einschränkungen beim Bargeldverkehr ein. Ob es für Sparer sinnvoll ist, Bargeld zu horten, beantwortet Markus Linke, Vermögensverwalter bei Swisspartners, im Video-Interview.
Früher galt es als undenkbar, dass man dem Staat etwas dafür bezahlen muss, um ihm Geld zu leihen. Heute ist dies Realität. Wie Sparer damit umgehen sollten, erklärt Anlageexperte Stephan Meschenmoser.
Die Geldschwemme der Zentralbanken hat die Zinsen von sicheren Geldanlagen in der Schweiz unter null gedrückt. Wie Sparer am besten auf diesen Anlagenotstand reagieren, erklärt der Vermögensverwalter Damian Gliott im Video-Interview.
2017 sollen die Krankenkassenprämien wieder erhöht werden, je nach Kanton zwischen 3,5 und 7,3 Prozent. Ein Experte erklärt im Video-Interview, wie Versicherte ihre Kosten reduzieren können.
Die britische Wirtschaft muss sich nach dem Brexit auf harte Zeiten einstellen. Auch in Europa und in der Schweiz werden die Folgen zu spüren sein, wie Konjunkturforscher Jan-Egbert Sturm im Interview erklärt.
Die Ökonomin und Autorin Dambisa Moyo gibt einen besorgniserregenden Ausblick für die Weltwirtschaft. Im Video-Interview spricht sie über die Folgen dieser Entwicklung.
Am Devisenmarkt ist das britische Pfund in der Nacht auf Freitag plötzlich um 6,1% eingebrochen. Einen Grossteil der Verluste holte die britische Währung später wieder auf. Händler sprechen von einem «Flashcrash».
Vier von fünf Vorsorgeeinrichtungen planen, wegen der negativen Zinsen den Anteil von Obligationen im Portfolio geringer zu gewichten. Andere Anlageklassen bieten Chancen, aber auch grössere Risiken.
2013 haben die EU-Staaten eine «Jugendgarantie» abgegeben, um mehr Jugendlichen einen Job oder eine Ausbildung zu verschaffen. Hinzu kamen Fördergelder der EU. Nun zieht Brüssel eine Zwischenbilanz.
Fast eine Woche nach dem Stromausfall im Süden Australiens warten vor allem industrielle Kunden weiter auf Strom. Nur wenige haben vorgesorgt.
Schrumpft die Wirtschaft, kommt es an den Börsen zu heftigen Korrekturen. Die Gefahr einer US-Rezession werde von den Märkten unterschätzt, heisst es bei der Deutschen Bank. Viel fehle dazu nicht.
Eine Velolampe gibt Auskunft darüber, wo das Strassennetz saniert werden muss – was nach Science-Fiction klingt, könnte bald möglich sein. Mehrere Milliarden Geräte sollen in den nächsten Jahren ans Netz angeschlossen werden. Wir erklären, wie das Internet der Dinge funktioniert.
Der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat Private Equity Fonds einst als Heuschrecken bezeichnet. Wir erklären, was sich hinter dem Begriff tatsächlich vebirgt.
Am Schweizer Energie- und Klimagipfel geben sich politische Entscheidungsträger die Klinke in die Hand. Doch die wirklichen Innovationen für eine klimafreundlichere Welt kommen von anderen.
Albrecht Ritschl gehört zu den bekanntesten Wirtschaftshistorikern. Sein Rat ist gefragt, erst recht seit Ausbruch der Finanzkrise. Seinen Beruf erachtet er oft als Selbstquälerei.
Tunesien hat den Übergang in die Demokratie abgeschlossen. Doch die Wirtschaft kommt nicht in Gang. Die Regierung will nun gegen Korruption und die postrevolutionäre Mafia entschlossener vorgehen.
Die Wirtschaftskommission des Ständerats stellt diese Woche die Weichen im Streit um Privilegien für Baulandbauern. Ein neues Papier der Verwaltung macht den Bauernvertretern das Leben schwer.
Am 23. Weltenergiekongress werden die rückläufigen und fast nur noch auf administrierter Basis getätigten Investitionen zu reden geben. Der Gastgeber erhofft sich viel vom Überraschungsgast Putin.
Die Schweiz tritt in Washington selbstbewusst auf. Sie kann sich dies dank einer vorbildlichen Haushaltspolitik leisten. Im IMF-Exekutivrat gibt sie nun aber den Direktorenposten ab.
Ford hat seine Autoproduktion in Australien eingestellt. Der letzte Falcon rollte am Freitag vom Band. Damit geht eine 91-jährige Geschichte zu Ende. Doch es kommt noch schlimmer für die Industrie.
Wer sich in der Euro-Zone nicht an den Fiskalpakt hält, wird vom Markt kaum bestraft. Den Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, stört das. Sein Vorschlag würde dazu beitragen, die Fehlanreize am Anleihemarkt abzubauen.
Auf den Philippinen hat der Drogenkrieg die wirtschaftspolitische Agenda der neuen Regierung verdrängt. Auch Wirtschaftsleute fragen sich, was nach den Tiraden und nach der Tötungsorgie kommt.
Der Deutschen Bank drohen aus zwei grossen Rechtsfällen immense Strafen, die ihre Rückstellungen übersteigen dürften. Nun machen Gerüchte die Runde, woher das Geld kommen könnte.
Im Handel mit Elektronikteilen werden pro Jahr zig Milliarden umgesetzt. Doch die Anbieter sehen sich hin- und hergerissen zwischen den Anforderungen der alten und der neuen digitalen Welt.
Die Ausmarchung um die Swissgrid-Beteiligung von Alpiq ist gütlich beigelegt worden. Die BKW und die Axpo kontrollieren künftig je gut einen Drittel der nationalen Netzgesellschaft.
Europäische Banken kommen durch Niedrigzinsen, Milliardenstrafen und den Umbruch in der Branche unter Druck. Vielen steht ein harter Sparkurs bevor. Zehntausende Stellen sind schon weg und weitere in Gefahr. Ein Überblick.
Die Galenica-Tochter Vifor Pharma erhält einen neuen Chef. Damit ist das Interregnunm, das im Mai, nach der Absetzung von Sören Tulstrup begonnen hatte, beendet worden.
Ein amerikanischer Richter hat bestätigt, dass der Fiat-Chrysler-Konzern (FCA) sich vor Gericht verantworten muss, weil er die Fahrzeugsicherheit in zwei Rückruffällen heruntergespielt haben soll.
In der Affäre um mutmassliche Geldwäsche für russische Kunden über 10 Mrd. $ verhängt die deutsche Finanzaufsicht wohl keine Geldstrafen. Hohe Bussen drohen aber weiter vor allem in den USA.
Am Sonntag, 2. Oktober, jährt sich das Grounding der Swissair zum fünfzehnten Mal. Der Nationalstolz war nach der grössten Firmenpleite der Nachkriegszeit tief verletzt. Der Schock war auch heilsam.
Binnen fünf Jahren erreichte die Swissair ihr bestes und ihr schlechtestes Jahresergebnis. Verfolgen Sie Aufstieg und Fall der Airline in unserer Infografik – mit nur einem Knopfdruck.
Als im Herbst 2001 die Swissair zahlungsunfähig wurde und ihre Flugzeuge am Boden bleiben mussten, ging mehr als «nur» ein Unternehmen unter. Die Airline mit dem Schweizer Kreuz auf dem Leitwerk hatte jahrzehntelang als eine Art Image-Botschafter der Schweiz in aller Welt gegolten. Ein Rückblick auf sieben Jahrzehnte helvetische Aviatik-Geschichte in Bildern.
Eineinhalb Jahrzehnte nach dem Grounding der Swissair tragen noch immer etliche Firmenklubs deren Namen, und eine 2010 gegründete Ehemaligenvereinigung zählt bereits über 3200 Mitglieder.
Das Grounding vor fünfzehn Jahren war zweifellos ein wirtschaftliches Desaster. Es war aber auch der Höhepunkt des Streits im bürgerlichen Lager. Seither ist viel passiert – sind die Wunden verheilt?
So dokumentierten die Berichterstatter der NZZ die letzten Wochen der «fliegenden Bank» bis zu ihrem Untergang.
Den 2. Oktober 2001 verbinden Schweizer Aviatik-Fans und Nostalgiker mit einem Bild: der «gegroundeten» Swissair-Flotte am Flughafen Zürich. Das Nationalheiligtum blieb an diesem Tag am Boden. Die für ihre Verlässlichkeit gepriesene Airline sorgte für internationale Schlagzeilen. Das kratzte am Selbstverständnis der Schweiz.
Am 2. Oktober 2001 bleiben die Flugzeuge der Swissair am Boden. Das Ereignis geht als «Swissair-Grounding» in die Geschichte ein und sorgt in der Politik und Bevölkerung für grosse Emotionen. Ein Rückblick auf die Ereignisse in Bildern.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Würden auch Wirtschaftsforscher des Auslands berücksichtigt, tauchten bekannte Namen in der Rangliste auf.
Ernst Fehr hängt sie alle ab und setzt sich im gesamten deutschsprachigen Raum an die Spitze. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es derweil zu gewichtigen Verschiebungen.
Die komplette Rangliste zählt 48 Ökonomen. Bei den einflussreichsten Institutionen steht die Universität Zürich an der Spitze, dicht darauf folgt die Universität St. Gallen.
Ernst Fehr ist der neue Star im deutschsprachigen Raum. Er führt die Ranglisten auch in den Nachbarländern an. Aus der Schweiz haben zwei weitere Ökonomen den Sprung über die Grenze geschafft.
Die Rangliste der einflussreichsten Ökonomen basiert auf den drei Teil-Rankings: Medien, Politik und Wissenschaft. Aufgenommen wird nur, wer sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Forschung wahrgenommen wird.
Die Durchleuchtung staatlicher Förderprogramme zeigt, dass Subventionen für privatwirtschaftliche Forschung und Entwicklung effektvoll sein können. Unklar bleibt, inwiefern dies zu Markterfolg führt.
Soll die EZB zum Mittel des «Helikopter-Geldes» greifen, um die Inflation anzukurbeln? Es darf bezweifelt werden, dass das Mittel gegen die chronische Nachfrageschwäche wirkt. Das Für und Wider von Helikoptergeld muss sorgsam abgewogen werden.
In Österreich scheinen Strukturprobleme nicht allzu gross zu sein. Es lässt sich viel mit der Konjunktur erklären. Probleme gibt es in der Bildung und im Hightech-Bereich.
Nepal zählt zu den ärmsten Ländern und ist auf Entwicklungshilfe angewiesen. Die Wirkung der ausländischen Unterstützung hängt auch vom Verhalten der Notenbank des Landes ab.
Die Flüchtlingspolitik steht vor zahlreichen Herausforderungen. Mit Charter Cities könnte Flüchtlingen geholfen werden, ohne dass deren Heimatregionen auf Dauer Arbeitskräfte verloren gehen.
Im Juni 2016 wurde der Mindestlohn in Deutschland angehoben. Bei dieser Entscheidung war die vorangehende Tarifentwicklung zentral. Künftige negative Nebeneffekte wurden ausgeblendet.
Der Harvard-Professor Dani Rodrik plädiert in seinem Buch über das Wohl und Wehe der Wirtschaftswissenschaften für weniger Überheblichkeit. Er lotet die Grenzen der Erklärungskraft von Modellen aus.
Die Uhrenbranche bekundet Mühe, effektiv auf neue technologische Herausforderungen und gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Die Gründe hierfür liegen in der Vergangenheit.
Hierarchien sind nicht nur veraltet, sondern auch hinderlich für den Erfolg einer Firma. Diese These vertritt der Psychologe und Firmenberater Felix Frei in seinem neuen Buch.
Ob Verwaltungsräte, Abteilungsleiter oder Politiker: Wer mit Geldanreizen menschliches Verhalten steuern will, kann in Fallen tappen. Sogar die Ökonomen haben dies bemerkt.
Salzwassserkrokodile wurden in Australien einst bist fast zur Ausrottung gejagt. Seit 40 Jahren stehen sie unter Schutz. Und tragen zur lokalen Wirtschaft bei.
Der Tsukiji-Fischmarkt in Tokio ist der grösste der Welt. Hier wechseln über 2000 Tonnen Fisch pro Tag den Besitzer. Was passiert da genau?
Port Hedland im Nordwesten Australiens ist der grösste Exporthafen für Schüttgut der Welt. 98 Prozent davon sind Eisenerz.
Grosse Teile der Mongolei sind ausgesprochen dünn besiedelt. Gleichzeitig wohnt die Hälfte der mongolischen Bevölkerung in der Hauptstadt Ulaanbaatar – und es werden immer mehr.
Deutsche Behörden haben diverse CD mit gestohlenen Bankdaten gekauft. Eine Hausdurchsuchung aufgrund solcher Daten sei rechtens gewesen, urteilt nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.
Das Bundesgericht ist zum Schluss gekommen, dass die Cornèr Bank keine Mitarbeiterdaten an die USA liefern darf. Der Schutz der Anonymität ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.
Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Tessiner Cornèr Bank abgelehnt. Diese darf die Namen von Anwälten nicht an die USA weiterleiten.























