
Die amerikanischen Haushalte machen seit einigen Jahren wieder neue Schulden. Während das Wachstum im Hypothekarbereich nachhaltig ist, scheint die Situation nun anderswo zu überborden.
Die grüne Fraktion im EU-Parlament hat die Steuer-Strategien von Ikea untersuchen lassen. Sie fordert politische Konsequenzen und eine wettbewebsrechtliche Untersuchung der EU.
Die Vorschläge des Bundesrats enthielten faktisch eine Grössenbegrenzung für die Schweizer Grossbanken. Dies sagt die Bankiervereinigung.
Die Negativzinsen und die wachsenden Anforderungen der Aufsicht machen den Banken zu schaffen. Trotzdem sieht Commerzbank-Chef Blessing keine Gefahr, dass sich die Finanzkrise wiederholen könnte.
Die 28 Volkswirtschaften der EU sind im vierten Quartal um 0,3% gewachsen. Von einem markanten Aufschwung kann dabei nicht die Rede sein.
Die Banken Europas werden dieser Tage so richtig durchgeschüttelt. Nur eine Stärkung ihrer Kapitalbasis kann sie wiederstandsfähiger machen.
Heimchen, Mehlwürmer und Wanderheuschrecken sollen in der Schweiz in Zukunft als Lebensmittel verkauft werden dürfen. Verschiedene Firmen wollen die Chance ergreifen. Doch droht ein Appetitverlust.
Die Frage wegen der Nachhaltigkeit der seit mehreren Jahren stabilen Dividende ist nicht vom Tisch. Unter Mario Greco könnte es auch in diesen Belangen zu einer Anpassung kommen.
Das bürgerlich dominierte Parlament hätte es in der Hand, das Wachstum von Regulierungen und Staatsausgaben zu bremsen. Doch an den Werktagen gilt die Sonntagsschulrhetorik oft nicht mehr.
Die Kurse europäischer Bankaktien kennen derzeit fast nur die Richtung nach unten. Die Marktreaktion ist übertrieben, doch die Probleme sind real. Es kursiert die Angst vor einer neuen Finanzkrise.
An den Börsen geht die Angst vor einer weltweiten Rezession um. In einer volatilen Handelswoche verlor der Swiss-Market-Index deutlich an Wert.
Ein Rekordverlust und miese Aussichten haben der Deutschen Bank seit Anfang Jahr zugesetzt. Nun ergreift sie die Flucht nach vorn: Mit dem Rückkauf eigener Anleihen will sie Vertrauen zurückgewinnen.
Die Märkte für Unternehmensanleihen haben an Liquidität eingebüsst. Dass immer mehr Anleger in diesem Bereich Fonds und ETF kaufen, vergrössert die Problematik.
In der Ukraine scheint sich die alte Elite weiter zu bereichern. Damit droht sie die Chance zum Systemwechsel zu verspielen. Neue Ideen sind gefragt. Kiew sollte Teile der Staatlichkeit auslagern.
Portugal hat den übrigen Euro-Staaten zugesichert, nötigenfalls weitere Massnahmen zu ergreifen, um die EU-Vorgaben für seinen Haushalt einzuhalten. Mit Athen wird eine Einigung bis Ostern erhofft.
Der Flirt mit Russland war ohne Tiefgang: Saudiarabien hält an der Politik der niedrigen Erdölpreise fest. Riad kann den Kurs wohl noch lange durchhalten. Iran wird viel zu leiden haben.
Obwohl der wichtigste Markt China erstmals seit 20 Jahren schwächelt, hat die Schindler-Gruppe ihre Ziele erreicht. Die Flaute in China wird als Chance betrachtet.
Die Zurich beharrt trotz einem schwachen Jahresergebnis auf der Auszahlung einer stabilen Dividende von 17 Fr. je Namenaktie. Das ist so viel Geld, dass Reserven angezapft werden müssen.
Walter Meier und Looser haben 2015 einen Teil der Firma an ihre Geschäftsführer verkauft. Weil die Käufer den Betrieb kennen, geht das schnell. Allerdings ist deshalb speziell auf den Preis zu achten.
Firmen brauchen nicht tatenlos zuzusehen, bis ihnen Quereinsteiger aus der Tech-Welt Geschäftsfelder wegnehmen. Auch Nichttechnologiekonzerne können sich die digitale Transformation zunutze machen.
Im Gegensatz zu den zu Hyperaktivität neigenden Angelsachsen passen sich hiesige Unternehmen eher vorsichtig der digitalen Transformation an. Ob sich die Passivität rächt?
Im Steuerstreit mit den USA haben sich auch kleine Regional- und Kantonalbanken für die Gruppe 2 des US-Programms gemeldet. Eine Übersicht zu allen erzielten Einigungen.
War Ludwig Erhard kein Neoliberaler? Diesen Eindruck gewinnt, wer das Buch von Horst Friedrich Wünsche liest. Penetrant versucht er, einen Keil zwischen Erhard und andere Liberale zu treiben.
Wie ist die Sharing-Economy ordnungspolitisch zu beurteilen? Das Jahrbuch «Ordo» erörtert die Frage u. a. anhand von Airbnb und kommt zum Schluss, dass Regeln des fairen Wettbewerbs verletzt werden.
Liberalismus ist eine machtvolle Idee, aber nicht nur das. Der Politikwissenschafter Rolf Steltemeier geht in seinem neuen Buch auch der Frage nach, wie die Idee in der realen Politik umgesetzt wird.
Die private Altersvorsorge in Deutschland wird zu wenig genutzt. Eine einfache Änderung des Systems könnte Abhilfe schaffen, ohne die Wahlfreiheit der Bürger einzuschränken.
Männer sind nicht nur risikofreudiger als Frauen. Sie lassen sich bei ihren Risikoentscheidungen auch stärker beeinflussen. In der Gruppe werden tendenziell höhere Risiken eingegangen als allein.
Kaufen ist derzeit günstiger als Mieten. Inititativen für bezahlbaren Wohnraum sollten deshalb darauf abzielen, Geringverdienern den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen.
Der Schweizerfranken hat bis zum Januar 2015 als sehr stabil gegolten. Viele Anleger waren geschockt, als er dann rasant erstarkte. Nun zeichnet sich eine weitere Normalisierung ab.
Seit der Aufgabe des Mindestkurses mehren sich die Stimmen, die sich um den Wirtschaftsstandort Schweiz sorgen. Die Wechselkurspolitik der Nationalbank ist aber weder das Problem noch die Lösung.
Ein Jahr nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses bleibt der Franken deutlich überbewertet. Solange die Euro-Zone ihre Probleme nicht in den Griff bekommt, dürfte sich daran wenig ändern.
Herrscht im Bundeshaus liberale Aufbruchstimmung? Fehlanzeige. Seit der Jahrtausendwende reguliert die Politik, was das Zeug hält. Der freiheitliche Bürgersinn verdient ein Comeback.
Dem neuen Parlament und Bundesrat fehlt es nicht an Herausforderungen. In welchen Bereichen ist ein Umdenken dringend, um das Land zukunftstauglich zu machen? Die NZZ hat eine Agenda aus liberaler Perspektive präsentiert. Folgendes bleibt zu tun.
Dem neuen Parlament und Bundesrat fehlt es nicht an Herausforderungen. In welchen Bereichen ist ein Umdenken dringend, um das Land zukunftstauglich zu machen? Die NZZ präsentiert in den kommenden Wochen eine Agenda aus liberaler Perspektive.
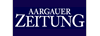
Der US-Internetgigant Facebook darf künftig auch in Frankreich verklagt werden. Ein Berufungsgericht in Paris entschied, dass die französische Justiz bei Rechtsstreitigkeiten zwischen dem sozialen Netzwerk und französischen Nutzern grundsätzlich zuständig ist.
Statt Blumen verschenken am Valentinstag immer mehr Leute Restaurantbesuche oder Hotelübernachtungen. Auch in der Schweiz: Hierzulande wird fast die Hälfte des Geldes, das für Valentinstags-Geschenke hingeblättert wird, in Restaurants ausgegeben.
Die Schweizer Pensionskassen sind schwach ins neue Jahr gestartet, wenn man auf die Erfolge ihrer Anlagerenditen schaut. Das Gesamtresultat, das sie mit ihren Kapitalanlagen im Januar erzielt haben, betrug nämlich -1,06 Prozent. Sie haben also Kapital vernichtet.
Die EU-Finanzminister haben einen Aktionsplan der EU-Kommission gutgeheissen, mit dessen Hilfe Terroristen der Geldhahn zugedreht werden soll. Zudem soll Brüssel einen Bericht zu einer Bargeld-Obergrenze und zur Abschaffung der 500-Euro-Note ausarbeiten.
Volkswagen hat vier Monate nach Bekanntwerden des Abgas-Skandals wieder seine Verkäufe gesteigert. Im Jahresvergleich legten die Auslieferungen des Konzerns im Januar um 3,7 Prozent auf 847'800 Autos.
Die Deutsche Bank will den Markt mit einem milliardenschweren Anleihe-Rückkauf beruhigen. Die Bank gab am Freitag ein öffentliches Kaufangebot bekannt.
Das Reich der Mitte will seine Stahl-Überproduktion im Ausland verhökern – und verdirbt damit weltweit die Preise.
Die Schweizer Uhrenindustrie sichert sich erfolgreich ihren Nachwuchs: 2015 haben Uhrenfirmen erneut mehr Lernende ausgebildet. Deshalb und weil künftige Lernende schon in den Startlöchern stehen, kann die Branche ihren Bedarf an qualifiziertem Personal selbst decken.
Die Schweizer Modekette Blackout ist schwer angeschlagen: Wegen einem Umsatzeinbruch Liquiditätsschwierigkeiten geht sie in Nachlassstundung. So hat sie Zeit, um einen Käufer und Investor zu suchen und den Konkurs abzuwenden. Blackout nennt mehrere Gründe für die Probleme.
Der Zukauf der Fondsgesellschaft Swisscanto hat sich für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) gelohnt. Sie hat den Gewinn um satte 12 Prozent auf 722 Millionen Franken gesteigert. Noch im Vorjahr musste sie Gewinneinbussen hinnehmen.
Nespresso-Konkurrent Ethical Coffee Company (ECC) macht mit seinen Ankündigungen ernst und verklagt die Nestlé-Tochter nun auch in Deutschland. Ziel ist der Verkaufsstopp von Nespresso-Kaffeemaschinen, welche die Kapsel von ECC nicht zulassen.
Schindler ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen und hat seinen Gewinn aus dem Geschäft steigern können. Der Luzerner Lifthersteller geht auch für das nächste Jahr von rosigen Aussichten aus - trotz schwächelnder Wirtschaft in China.
Ärzte dringend gesucht: Krankenkassen, Spitäler und weitere Investoren dürften mehr als 100 Gruppenpraxen bauen.
Der grösste nordamerikanische Versicherer AIG ist im vierten Quartal wieder in die roten Zahlen gerutscht. Ebenso haben die Rabattcoupon-Internetseite Groupon und das Internetradio Pandora einen Verlust hinnehmen müssen.
Nach mehreren Monaten ist ein Gasleck in der Nähe von Los Angeles nach Angaben der Betreiberfirma "vorläufig" unter Kontrolle. Nun werde daran gearbeitet, das Leck dauerhaft zu schliessen, teilte das Unternehmen Southern California Gas am Donnerstag mit.
Die Börsenkurse haben am Donnerstag ihre Talfahrt fortgesetzt. Das hat mehrere Gründe.
Die Steuerermittlungen der EU-Kommission gegen US-Konzerne stossen bei der Regierung in Washington auf deutlichen Widerstand. Die Unternehmen würden "unverhältnismässig ins Visier genommen", hiess es in einem Brief von US-Finanzminister Jack Lew.
Beim Internationalen Währungsfonds (IWF) steht einer zweiten Amtszeit von Chefin Christine Lagarde praktisch nichts im Wege. Die in Washington ansässige internationale Finanzinstitution hat die Französin für eine zweite Amtszeit nominiert.
Der Stellenabbau beim Versicherungskonzern Zurich steht deutlich für einen Trend. Auch im Dienstleistungssektor fallen nun vermehrt Jobs einem tiefgreifenden Umbau innerhalb der Branche zum Opfer.
Tiefrote Aussichten für die AHV: Die Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO haben im vergangenen Jahr mit ihren Kapitalanlagen erstmals seit Jahren hohe Verluste geschrieben. Ohne diese Rendite fehlt aber das Geld, um ein Minus bei der AHV auszugleichen.























