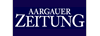
ABB Konzernchef Spiesshofer hat drei Probleme — und allen Grund, einen Italiener zu loben. Und er erzählt sogar eine Erfolgsgeschichte.
Implenia-Verwaltungsratspräsident Hubert Achermann zieht sich per sofort aus dem Spitzengremium des Baukonzerns zurück. Der Rücktritt habe persönliche Gründe, teilte Implenia am Mittwochabend mit.
Für 43,7 Milliarden Franken will der chinesische Chemie-Konzern ChemChina die Basler Syngenta übernehmen. Was mit Firmen geschehen kann, die nach China verkauft werden, zeigen diese fünf Beispiele.
Die amerikanische Backwaren-Kette Dunkin' Donuts eröffnet am 1. März in Basel ihr erstes Geschäft in der Schweiz. In den nächsten sieben Jahren sollen 30 Filialen entstehen.
Die Schweizer Autohändler sind gut ins neue Jahr gestartet. Im Januar sind in der Schweiz und Liechtenstein 20'205 Autos erstmals in Verkehr gesetzt worden. Das sind 1805 mehr als vor einem Jahr, wie der Branchenverband Auto Schweiz am Mittwoch mitteilte.
Der Elektronikkomponenten-Hersteller Schaffner hat in Luterbach am Mittwoch ein neues Hightech-Labor in Betrieb genommen. Die international tätige Gruppe investierte rund eine Million Franken.
Der Zementriese LafargeHolcim hat in Frankreich eine Restrukturierung angekündigt, um die Überkapazitäten am Markt zu reduzieren. Dazu zählt der Umbau von zwei Standorten von Zement- zu Mahlwerken, womit ein Stellenabbau von rund 200 Arbeitsplätzen verbunden ist.
Der Gotthard-Basistunnel soll nicht nur der längste Tunnel der Welt sein, sondern auch einer der sichersten. Die SBB will dies nicht nur mit modernster Technik, sondern auch mit gut ausgebildetem Personal erreichen.
46 Tage, 215 Kilometer Kabel und 416 Kilo Farbe in eineinhalb Minuten – viel Spass beim Zuschauen, wenn eine Boeing 777-300 ER gebaut wird.
Der japanische Autobauer Toyota entschädigt Afroamerikaner und Asiaten, die beim Autokauf in den USA draufzahlen mussten. Der Diskriminierungsfall wurde mit einem Vergleich über 21,9 Millionen Dollar beigelegt.
Fast 600 Personen arbeiten im Kanton Aargau für den Basler Agrochemie-Konzern Syngenta. Nach dem Alstom-Schock fürchten viele im Kanton, dass weitere Stellen verloren geht. Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann erklärt, warum ihm eine chinesische Übernahme von Syngenta lieber ist, als eine US-amerikanische.
Das Museum für Kommunikation will ab kommendem August die in die Jahre gekommenen Dauerausstellungen rundum erneuern. Altbekannte Evergreens werden verschwinden - nicht aber die bei den Kindern beliebte Rohrpost.
Strassenblockaden griechischer Bauern haben an zahlreichen Grenzübergängen zu Bulgarien und der Türkei chaotische Zustände ausgelöst. Die Bauern protestieren gegen geplante Erhöhungen ihrer Rentenbeiträge und ihrer Steuerlast.
Das Gerücht bestätigt sich: Die chinesische ChemChina kauft den Basler Agrochemie Syngenta für 43,7 Milliarden Franken. Der Verwaltungsrat von Syngenta empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen.
Der Abwärtstrend auf dem Schweizer Arbeitsmarkt könnte bald zu Ende sein. Der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich rechnet zwar weiterhin mit einem Stellenabbau, jedoch scheint die Talsohle durchschritten.
Das "Dach Indochinas", die Spitze des höchsten Bergs in Vietnam, ist neuerdings mit einer Seilbahn zu erreichen.
Der starke Franken und die Zinssituation an den Märkten hinterlässt tiefe Spuren im Ergebnis des weltgrössten Uhrenkonzerns Swatch. Der Umsatz ging um 3 Prozent auf 8,451 Mrd. Fr. zurück. Der Gewinn schrumpfte gar um 21 Prozent auf 1,119 Mrd. Franken.
Der Industriekonzern ABB muss für das vergangene Geschäftsjahr herbe Rückschläge einstecken. Die Schwache Erdöl- und Erdgas-Industrie drücken auf Umsatz und Gewinn.
Der Schweizer VW-Importeur AMAG hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen damit begonnen, Dieselmotoren mit Schummelsoftware umzurüsten. Zuerst ist das Modell Volkswagen Amarok dran. Die Nachbesserung aller betroffenen Autos wird das ganze Jahr über andauern.
Der US-Bundesstaat Kalifornien geht gegen eine Energiefirma vor, die für ein Gasleck in der Nähe von Los Angeles verantwortlich sein soll. Wegen des Lecks, aus dem weiter Methan strömt, mussten rund 4500 Familien ihre Häuser bereits verlassen.

Chinas führender Chemiekonzern sucht mit Syngenta nach einer Ergänzung des klassischen Petrochemie-Geschäfts. Aber auch nationale Interessen werden verfolgt, für die kein Preis zu hoch ist.
Der starke Mann bei Chem China, Ren Janxin, hat nicht nur ein für den Chef eines Staatsunternehmens ungewöhnliches Auftreten, auch sein Werdegang ist alles andere als typisch.
In der EU ist der Weg frei für die Einführung von «Strassentests» für neue Autos. Das Parlament hat auf ein Veto verzichet, obwohl die Vorgaben aus Sicht vieler Abgeordneter zu wenig streng sind.
Trotz einem harten Kostensenkungsprogramm ist es Lenovo noch nicht gelungen, einen Umsatzrückgang abzuwenden. Währungseffekte und die nachlassende Nachfrage im PC-Geschäft fordern ihren Tribut.
Der Vorschlag des Ständerats zur Reform der AHV hinterlässt den kommenden Generationen noch grössere Hypotheken als die Vorlage des Bundesrats. Das zeigen neue Berechnungen.
Auf der Bühne der Wirtschaftswelt kommt der Rezession die Rolle des Bösewichts zu. Oft wird die Rezession aber zu Unrecht schlechtgemacht.
Viele Unternehmen können mehr tun, um in der digitalen Welt à jour zu bleiben. Dennoch ist blinder Aktivismus fehl am Platz. Firmen tun gut daran, sich auf ihre traditionellen Stärken zu besinnen.
Die Spuren des Zerfalls des Erdölpreises sind unübersehbar in den Jahresergebnissen von «Oil majors» wie Chevron, BP oder ExxonMobil. Dadurch geraten die Ausschüttungen an die Aktionäre ins Wanken.
Die Zukunft der Personenfreizügigkeit Schweiz - EU steckt im dichten Nebel. Bis zur Klärung ist ein Marschhalt beim Schweizer Lohnkartell angebracht.
Die Pensionierten entwickeln sich langsam, aber sicher zur wichtigsten Nachfragergruppe am Wohnungsmarkt. Ihre Bedürfnisse werden jedoch noch ungenügend berücksichtigt.
ar Ludwig Erhard kein Neoliberaler? Diesen Eindruck gewinnt, wer das Buch von Horst Friedrich Wünsche liest. Penetrant versucht er, einen Keil zwischen Erhard und andere Liberale zu treiben.
Wie ist die Sharing-Economy ordnungspolitisch zu beurteilen? Das Jahrbuch «Ordo» erörtert die Frage u. a. anhand von Airbnb und kommt zum Schluss, dass Regeln des fairen Wettbewerbs verletzt werden.
Liberalismus ist eine machtvolle Idee, aber nicht nur das. Der Politikwissenschafter Rolf Steltemeier geht in seinem neuen Buch auch der Frage nach, wie die Idee in der realen Politik umgesetzt wird.
Chinesische Übernahmen werden trotz Wachstumsverlangsamung und Börsenturbulenzen in der Heimat zunehmen – und sich sogar beschleunigen.
Der Derivate-Verband generiert mit seiner neuen Statistik einige interessante Erkenntnisse. Der Devisenmarkt etwa ist wichtiger als der Aktienmarkt. Die Zahlen gleichen einer Herstellungsstatistik.
Banken belasten die Guthaben von Pensionskassen mit Negativzinsen. Daraufhin haben mehrere Vorsorgeeinrichtungen Rechtsanwälte eingeschaltet. Juristen sind sich in der Angelegenheit uneins.
Der Abwärtstrend auf dem Schweizer Arbeitsmarkt könnte bald zu Ende sein. Der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle rechnet zwar weiterhin mit einem Stellenabbau, jedoch scheint die Talsohle durchschritten.
Entgegen dem Wunsch des Bundesrats konnten sich die Sozialpartner nicht auf einen Ausbau des Flankenschutzes zur Personenfreizügigkeit einigen. Der Bundesrat könnte trotzdem eine Vorlage bringen.
«Follow the money»: In einem Aktionsplan legt die EU-Kommission Pläne zur Austrocknung der Finanzierungsquellen von Terrororganisationen sowie zur Aufdeckung ihrer Finanztransaktionen dar.
Der Internetkonzern steckt so tief in der Krise, dass er 15 Prozent der Stellen streicht und sich selbst zum Verkauf stellt. Der Umstrukturierungsplan von Chefin Marissa Mayer scheint gescheitert.
Die Credit Suisse wird am Donnerstag einen Verlust in Milliardenhöhe bekanntgeben. Hauptgrund dafür sind Goodwill-Abschreibungen, Restrukturierungskosten und Rückstellungen für Rechtsrisiken.
Der gemessen am Börsenwert weltgrösste Erdölkonzern stutzt sein Investitionsbudget drastisch und stoppt die Aktienrückkäufe. Damit reagiert er auf den starken Zerfall des Erdölpreises.
Im Steuerstreit mit den USA haben sich auch kleine Regional- und Kantonalbanken für die Gruppe 2 des US-Programms gemeldet. Eine Übersicht zu allen erzielten Einigungen.
Novartis hat in Afrika ein Programm lanciert, das Bedürftigen einen einfacheren Zugang zu Medikamenten ermöglichen soll. Auf lange Frist soll das Projekt auch Gewinn abwerfen.
Gewinnstreben gehört nicht zu den Postulaten der Corporate Social Responsibility. Doch gerade Profitabilität bildet die Basis für Nachhaltigkeit, wie ein Hilfsprojekt von Novartis in Kenya zeigt.
80 Prozent der Menschen mit Gehörproblemen leben in der Dritten Welt. In Kambodscha etwa sind es 2 Millionen. Mit einer Stiftung engagiert sich Sonova auch dort, wo der Markt wenig verspricht.
Die private Altersvorsorge in Deutschland wird zu wenig genutzt. Eine einfache Änderung des Systems könnte Abhilfe schaffen, ohne die Wahlfreiheit der Bürger einzuschränken.
Männer sind nicht nur risikofreudiger als Frauen. Sie lassen sich bei ihren Risikoentscheidungen auch stärker beeinflussen. In der Gruppe werden tendenziell höhere Risiken eingegangen als allein.
Kaufen ist derzeit günstiger als Mieten. Inititativen für bezahlbaren Wohnraum sollten deshalb darauf abzielen, Geringverdienern den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen.
Der Schweizerfranken hat bis zum Januar 2015 als sehr stabil gegolten. Viele Anleger waren geschockt, als er dann rasant erstarkte. Nun zeichnet sich eine weitere Normalisierung ab.
Seit der Aufgabe des Mindestkurses mehren sich die Stimmen, die sich um den Wirtschaftsstandort Schweiz sorgen. Die Wechselkurspolitik der Nationalbank ist aber weder das Problem noch die Lösung.
Ein Jahr nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses bleibt der Franken deutlich überbewertet. Solange die Euro-Zone ihre Probleme nicht in den Griff bekommt, dürfte sich daran wenig ändern.
Herrscht im Bundeshaus liberale Aufbruchstimmung? Fehlanzeige. Seit der Jahrtausendwende reguliert die Politik, was das Zeug hält. Der freiheitliche Bürgersinn verdient ein Comeback.
Dem neuen Parlament und Bundesrat fehlt es nicht an Herausforderungen. In welchen Bereichen ist ein Umdenken dringend, um das Land zukunftstauglich zu machen? Die NZZ hat eine Agenda aus liberaler Perspektive präsentiert. Folgendes bleibt zu tun.
Dem neuen Parlament und Bundesrat fehlt es nicht an Herausforderungen. In welchen Bereichen ist ein Umdenken dringend, um das Land zukunftstauglich zu machen? Die NZZ präsentiert in den kommenden Wochen eine Agenda aus liberaler Perspektive.
Die Stimmung am Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos war sehr gedrückt. Es zeigte sich eine problematische Fixierung auf das kurzfristige Börsengeschehen. Dabei gibt es gute Gründe für mehr Zuversicht.
Der Sturz am Aktienmarkt wird stark durch Staatsfonds aus Nahost getrieben, wie sich am WEF erfahren liess. Auch reiche Privatkunden reduzieren Risiken. Sorge bereitet Beobachtern auch die Geldpolitik.
Er war Notenbankchef und ist Autor zahlreicher Lehrbücher. Jakob A. Frenkel glaubt nicht, dass diese völlig neu geschrieben werden müssen. Stattdessen setzt er auf eine geldpolitische Normalisierung.























