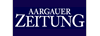
Die griechische Regierung hat sich nach eigenen Angaben mit ihren internationalen Gläubigern auf die Auszahlung einer weiteren Milliardentranche aus dem Hilfspaket geeinigt. Es gebe eine Einigung zu den Bedingungen für die Auszahlung von einer Milliarde Euro.
Das Polizeigericht in Genf hat einen Genfer Banker vom Vorwurf der ungetreuen Geschäftsführung mit dem Ziel der Bereicherung freigesprochen. Der Genfer Kanton muss dafür nun in die Tasche greifen.
Die Volkswagen-Kernmarke VW hat in den ersten elf Monaten des Jahres einen deutlichen Rückgang der weltweiten Verkaufszahlen hinnehmen müssen. Von Januar bis November konnte VW nur 5'335'700 Fahrzeuge absetzen, das sind 4,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Die türkische Behörde für Informationstechnologie (BTK) hat erstmals eine Geldstrafe gegen den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter verhängt. Die BTK verfügte, dass Twitter eine Strafe von 150'000 Lira (rund 50'000 Franken) zahlen muss.
Der Swiss-Chef Harry Hohmeister hat vor seinem Wechsel zum Mutterkonzern Lufthansa die Politik aufgefordert, sich klar zur europäischen Luftfahrtindustrie zu bekennen. Die Swiss brauche für ihr Investitionsprogramm von 3 Milliarden Franken stabile Rahmenbedingungen.
Der Bundesrat will gegen illegale Gratis-Angebote im Internet vorgehen. Er hat am Freitag Vorschläge zur Änderung des Urheberrechts in die Vernehmlassung geschickt.
Der Bundesrat will gegen illegale Gratis-Angebote im Internet vorgehen. Er hat am Freitag Vorschläge zur Änderung des Urheberrechts in die Vernehmlassung geschickt.
In der Chemiebranche kommt es zu einer Mega-Fusion: Die US-Grosskonzerne Dupont und Dow Chemical wollen sich zusammenschliessen. So entsteht der weltgrösste Chemiekonzern noch vor der bisherigen Nummer Eins BASF aus Deutschland.
Der Bundesrat will künftig strenger gegen unverhältnismässig hohe internationale Roaminggebühren und unerwünschte Werbeanrufe vorgehen können. Dafür sorgen soll eine Teilrevision des Fernmeldegesetzes.
Die SRG soll weiterhin über Gebührengelder und Werbeeinnahmen finanziert werden. Das empfiehlt die vom Bundesrat eingesetzte Medienkommission. Sie fordert aber mehr Transparenz über die Kosten.
Die Internationale Energieagentur IEA geht vorerst nicht von einem Abebben der Ölschwemme aus. Das Überangebot am Weltmarkt werde mindestens bis spät ins Jahr 2016 anhalten, heisst es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der IEA.
Die amerikanische Gesellschaft Z#Capital#Partners ist die neue Besitzerin des traditionsreichen Luxushotels Waldhaus im Bündner Ferienort Flims. Die Gesellschaft will das 1877 erbaute Haus weiterführen und aufwerten in ein Fünf-Sterne-Luxushotel.
Schweizer Unternehmen haben erstmals seit Jahren Geld aus dem Ausland abgezogen, statt zu investieren. 2014 lagen die schweizerischen Direktinvestitionen hinter der Landesgrenze mit rund 3 Milliarden Franken im negativen Bereich, was einen Kapitalabzug bedeutet.
Dank der EZB kann die SNB vorerst auf noch negativere Zinsen verzichten
Im Geschwindigkeitsrennen zwischen der Swisscom und den Kabelnetzbetreibern tritt der «Blaue Riese» aufs Gas: Auf dem Kupfernetz soll das Tempo in den Gemeinden auf dem Land bis zum Fünffachen beschleunigt werden.
Die Bank Coop und die Cornèr Bank haben sich im Steuerstreit mit dem US-Justizministerium (Departement of Justice, DoJ) geeinigt. Um nicht weiter strafrechtlich verfolgt zu werden, zahlt die Bank Coop 3,223 Millionen Dollar, die Cornèr Bank 5,068 Millionen Dollar.
Der Autobauer Fiat Chrysler muss wegen nicht übermittelter Unfall-Berichte 70 Millionen Dollar Strafe an die US-Verkehrsaufsicht zahlen.
Die vorwiegend auf Schuhe spezialisierte Ladenkette Navyboot wird das Geschäftsjahr 2015 mit roten Zahlen abschliessen. Ursprünglich waren schwarze Zahlen beim Betriebsergebnis als Ziel für dieses Jahr vorgesehen gewesen.
Der Möbelriese IKEA leidet unter dem starken Franken. Im Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Schweizer Tochter weniger Geld verdient. Der Umsatz sank um 1,3 Prozent auf 1,03 Milliarden Franken, wie IKEA am Mittwoch mitteilte.
Die Volkswagen-Spitze hat bei der Suche nach Verantwortlichen für den weltweiten Diesel-Skandal weiterhin nur einen relativ kleinen Kreis von Verdächtigen im Visier.

Die bisher grösste Fusion im Chemiesektor ist eine konsequente Antwort auf Veränderungen in der fragmentierten Branche. Ob die komplexe Transaktion die hohen Erwartungen erfüllt, ist fraglich.
Es scheint, als werde der chinesische Finanzmagnat und Fosun-Besitzer Guo Guangchang zurzeit verhört. Allerdings ist unklar, ob als Beklagter oder nur als Zeuge.
Frankreichs Regierung hat sich zur Beschneidung ihrer Stimmrechte bei Renault bereitgefunden. Das allerdings nur bei unbedeutenden Traktanden.
Nestlé pflegt seine Schweizer Identität, muss sich aber global orientieren. CEO Paul Bulcke appelliert an die Schweizer, die Stärken ihres Standorts nicht kaputt zu machen.
Der Bundesrat will beim Roaming und den Werbeanrufen durchgreifen. Im Bereich Netzneutralität setzt er auf Transparenz. Der umstrittensten Punkt der Gesetzesrevision wird derweil aufgeschoben.
Die beiden US-Konzerne Dow und DuPont verschaffen sich durch ihren geplanten Zusammenschluss deutlich mehr Marktmacht. Zu spüren bekommen werden das besonders die Konkurrenten Syngenta und Monsanto.
Mit dem Mut der Verzweiflung wird in den Schweizer Alpen in die touristische Infrastruktur investiert. Es wird ein böses Erwachen geben.
Die gegenwärtige Frankenstärke ist nicht einmalig, aber schmerzhaft. Sie zwingt die Wirtschaft zu forcierten Anpassungsleistungen, für die eine höhere Produktivität der Schlüssel ist.
Die gesamte Welt wartet auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank nächste Woche – auch die britischen Währungshüter.
Der japanische Schreibwaren-Hersteller Mitsubishi Pencil wollte seine Farbstift-Produktion einstellen. Doch dann erhoben sich die Manga-Zeichner und ihre Superhelden.
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist plötzlich geringer als in der Schweiz. Eine Analyse aber zeigt: Die Schweiz ist noch gut positioniert – der Nachbar hat nur einen Teil der Defizite aufgeholt.
Die Entlassung des geachteten Finanzministers Nene hat Südafrikas Finanzmärkte über Nacht in eine der schwersten Krisen in der Geschichte des Landes gestossen.
Die Marktteilnehmer sind ratlos angesichts der hohen Kursrückschläge. Nun hoffen sie darauf, dass sich das Jahr 2014 wiederholt.
Die jüngste Reaktion auf die EZB-Ankündigung hat gezeigt, dass der Grenznutzen zusätzlicher Notenbank-Euro abnimmt. Die Märkte bewegen sich langsam, aber sicher Richtung Normalität.
IMF-Gelder sollen künftig auch dann fliessen können, wenn das Krisenland nicht mit all seinen Gläubigern im Reinen ist. Schuldenkrisen sollen so weniger Kosten verursachen.
Gastrosuisse, Konsumentenschützer und KMU-Vertreter haben einen Initiativtext für «faire Importpreise» ausgetüftelt. Der Text ist interpretationsbedürftig, die Übergangsbestimmungen sind umfangreich.
Jacob Zuma ersetzt den hochgeschätzten Nene durch einen unbekannten ANC-Veteranen. Damit bringt der Staatspräsident den wichtigsten Stabilitätsgaranten für Investoren unter seine Kontrolle.
Der belgische Allfinanzkonzern KBC zahlt die letzte Tranche der in der Krise erhaltenen Staatshilfe vorzeitig zurück. Damit endet ein düsteres Kapitel, in dem die KBC viele Federn lassen musste.
Erstmals seit vielen Jahren schaffen es zurzeit viele Fluggesellschaften, aus dem laufenden Geschäft genügend Gewinn für Neuinvestitionen zu erwirtschaften.
Die CKW haben erneut Abschreibungen in Millionenhöhe auf Kraftwerken und Bezugsverträgen wegen tieferer Absatzpreise vornehmen müssen. Sie fallen aber geringer aus, was den Gewinn erhöht.
Dem neuen Parlament und Bundesrat fehlt es nicht an Herausforderungen. In welchen Bereichen ist ein Umdenken dringend, um das Land zukunftstauglich zu machen? Die NZZ präsentiert in den kommenden Wochen eine Agenda aus liberaler Perspektive.
Die Altersvorsorge ist von staatlichen Regulierungen und Zwang geprägt. Entlang liberaler Grundwerte sind freiheitlichere Züge der Altersvorsorge nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.
Ob Energie, Logistik oder Telekommunikation: Überall geschäftet der Staat munter mit. Kaum jemand schert sich hierzulande noch um ordnungspolitische Grundsätze. Es ist höchste Zeit, Staat und Privatwirtschaft wieder klar zu trennen.
Im Steuerstreit mit den USA haben sich auch kleine Regional- und Kantonalbanken für die Gruppe 2 des US-Programms gemeldet. Eine Übersicht zu den bisher erzielten Einigungen.
Immer mehr Banken der Gruppe 2 im US-Programm einigen sich mit den US-Behörden. Die publizierten Dokumente zeigen das Verhandlungsgeschick der einzelnen Banken und von deren Anwälten und Beratern.
Die drei jüngsten Einigungen von Schweizer Banken mit den amerikanischen Behörden zeigen erneut, dass die USA alle Informationen genauestens abwägen, bevor die Bussenhöhe bestimmt wird.
Firmenorganisationen kranken oft daran, dass sich Mitarbeiter zu wenig austauschen. An grossen, zentralen Standorten sollen Informationen schneller fliessen. Beweisen lässt sich das jedoch kaum.
Erst als die zweite Managerin ins fünfköpfige Führungsgremium einer Versicherung gewählt wurde, veränderte sich die Diskussionskultur. Wo Frauen in der Berufswelt an unsichtbare Barrieren stossen.
Der Pharmakonzern Pfizer will mit der Übernahme des irischen Konkurrenten Allergan Steuern sparen. Dabei geht es um Beträge in Milliardenhöhe, wie ein Blick in die Bücher zeigt.
Jean Solchany geht in seinem Buch nicht nur mit Zuneigung an Wilhelm Röpke heran. Er skizziert auch die Schattenseiten und Entgleisungen des deutschen Ökonomen.
Rudolf Schild-Comtesse galt in seiner Zeit als einer der mächtigsten Männer der Schweizer Uhrenindustrie. Ein Buch über das Leben und Werk eines Uhrenpatrons alter Schule.
Nach den Terroranschlägen von Paris dürfte in Europa der Druck in Richtung Überwachungsstaat noch grösser werden. Doch die Privatsphäre muss geschützt bleiben, wie ein neues Buch deutlich macht.
Der unerklärte Teil der Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen wird häufig mit Diskriminierung gleichgesetzt. Die Messung von Lohndiskriminierung birgt allerdings grosse methodische Tücken.
Das OMT-Programm der EZB hat zu einer impliziten Solidarhaftung für Staatsschulden in Europa geführt. Die dadurch entstandenen Fehlanreize könnten durch Accountability-Bonds korrigiert werden.
In der Entwicklungshilfe gilt, dass Koordination unter den Geberländern gut und die Fragmentierung des Angebots im Gegenzug schädlich ist. Diese Annahmen müssen allerdings relativiert werden.























