
Im Nachgang zur «Lex Netflix» ist am Filmfestival in Locarno die Allianz Cinéconomie lanciert worden. Sie will auch zeigen, dass die Filmwirtschaft «keine linke Angelegenheit ist».
Schwere Verbrechen wie Tötungs- oder Sexualdelikte sollen mit DNA-Analysen über das Aussehen des Täters gelöst werden. Das ist gut so. Doch ein Wundermittel ist das Phenotyping nicht.
Hunderttausende Wähler orientieren sich an den Fragebogen von Smartvote. Umso brisanter sind Auswahl und Formulierung der Fragen. Sie sorgen oft für Diskussionen. In einem Fall sind diese soeben eskaliert.
Seit 15 Jahren gibt es in den Waadtländer Voralpen ein Grossprojekt mit Schneekanonen. Für die Gegner stammt das Vorhaben aus einer anderen Zeit.
Mehrere grössere Landschaften senken sich in wenigen Jahren um bis zu 15 Zentimeter. Das führt zu Problemen bei der Vermessung.
Schweizerinnen und Schweizer ärgern sich weniger über Themen, wie sie Wokeness-, Gender- oder Klimakleber-Gruppen vertreten, als vielmehr über den Stil der Auseinandersetzung. Das ist neu und ein Grund zur Sorge.
Sollen die Schulferien verkürzt werden? Nein, sagt der Urner Nationalrat und Primarlehrer Simon Stadler. Nicht alles, was man für das Leben lernen müsse, lerne man in der Schule.
Der Bundespräsident preist den Schweizer Film – allerdings mit Argumentationslücken. So geschehen an der alljährlichen Medienkonferenz zur Kulturpolitik in Locarno.
Die Stiftung «Éducation 21» soll Lehrer beim Unterricht über Nachhaltigkeit unterstützen. Viele der angebotenen Materialien haben eine politische Schlagseite. Gefördert werden die Projekte häufig von deutschen Organisationen oder Ministerien.
2015 wurde im Kanton Luzern eine Frau vergewaltigt und schwer verletzt. Die ganze Schweiz war schockiert. Bis heute konnte das Verbrechen nicht aufgeklärt werden. Doch jetzt schöpft die Staatsanwaltschaft neue Hoffnung.
Mit aller Kraft macht die Volkspartei die Migration zum Thema im Wahlkampf, vorab mit ihrer Initiative gegen eine «10-Millionen-Schweiz». Ihren Gegnern wirft sie vor, die Schweiz «aufgegeben» zu haben.
Auf Sattel-Hochstuckli spielt sich ein Kampf ab, der angesichts des Schneemangels anderen Skigebieten noch bevorsteht.
Wie der «Alpenblick» zum Gasthaus des Anstosses wurde.
Der Grünen-Chef erzählt, warum er sich als Kind auf die Bücher stürzte, wie er mit Ebay hätte reich werden können und welche anderen Chancen im Leben er verpasste.
Die SP-Co-Präsidentin erzählt, dass sie eigentlich Architektin werden wollte, warum sie den Gedanken ans Sterben verdrängt und welche Entscheidung sie im Leben bereut.
In Brienz ist ein von Felsmassen bedrohtes Dorf evakuiert worden – was erzählt uns der Umgang mit Naturkatastrophen über die Schweiz?
Die Seele reparieren wie eine Autokarosserie: Darum rennen alle zu Lebenscoaches.
Direkte Waffenlieferungen an eine Kriegspartei: Amherd ignorierte die rote Linie und liess Ruag und Rheinmetall bereits Verträge unterschreiben, ohne den Bundesrat zu fragen.
Die Armee erhält etwas mehr Geld. Doch wofür? Eine Analyse dreier Szenarien aus Schweizer Perspektive.
Die Schweiz hat das Verbot an vorderster Front unterstützt, damit aber die Kampfkraft ihrer Artillerie markant geschwächt.
Der Kreml äussert sich besorgt über die Menschenrechtslage in der Schweiz. Ein Tweet der russischen Uno-Vertretung in Genf zeigt, wie der Informationskrieg gegen die westlichen Demokratien funktioniert.
Der ehemalige Präsident Estlands Toomas Hendrik Ilves über die Wehrbereitschaft der liberalen Demokratie – und darüber, was die Schweiz davon lernen kann.
1957 spricht der Schweizer Botschafter in Moskau vor dem sowjetischen Fernseh- und Radiopublikum über die Bedeutung des Bundesfeiertags – in perfektem Russisch. Blick zurück auf eine ungewöhnliche Diplomatengeschichte aus dem Kalten Krieg.
Während des Zweiten Weltkriegs hält ein glühender Anhänger der religiösen Mazdaznan-Bewegung die Zensurbehörde auf Trab – mit einem «abstrusen Gemisch nationalsozialistischer Ideen und Naturheillehren». Ein Blick zurück.
Heute hetzen die Mitglieder der Landesregierung um die Welt – früher galt die internationale Besuchsdiplomatie als unnütz und unschweizerisch. Wieso eigentlich? Ein Blick zurück.
Ein Brett, vier Räder – viel Geschick und Mut: In den 1970er Jahren erfasste die Skateboard-Welle auch die Schweiz. Was heute olympische Disziplin ist, war damals höchst umstritten. Ein Blick zurück.
Von aussen betrachtet, ist die Schweiz ein unmögliches, unübersichtliches Gebilde. Diese Komplexität ergibt nicht nur Sinn, sie ist auch einer der grössten Vorzüge.
Der Forderung nach einem neuen nationalen Koordinationsgremium und einer verstärkten Zusammenarbeit sollten grundlegende staatspolitische Überlegungen vorausgehen.
Das Zweikammersystem mit National- und Ständerat ist eine der grossen Stärken der Schweiz. Der Föderalismus ermöglicht es, dass jeder Kanton für sich die individuell passende Lösung finden kann.
Der Schweizer Föderalismus hat eine einzigartige Entwicklung hinter sich. 1848 noch als duales Modell nach US-amerikanischen Vorbild konzipiert, hat er sich zum Paradebeispiel administrativer Prägung entwickelt. Doch Mitwirkungsinstrumente wie beim deutschen Modell fehlen weitgehend, und auch bei den Finanzströmen wäre es Zeit zum Aufräumen.
Schon bald startet nach den Sommerferien das Abenteuer Schule. Warum es Müttern und Vätern so schwerfällt, loszulassen.
An mehreren Schulen kam es jüngst zu Dutzenden Kündigungen von Lehrern. Als Grund wurde immer der Schulleiter genannt. Was ist da los? Im Gespräch mit der Lehrerin Claudia Jakob und dem Schulleiter Kerem Yildirim.
Der Lehrermangel in Zürich ist noch immer akut. Die Rudolf-Steiner-Schulen spüren ihn noch stärker als die Volksschulen. Das hat mit Vorurteilen zu tun – aber nicht nur.
Überdurchschnittlich intelligente Kinder sind eine Herausforderung für Schulen und Eltern. Tut die Schweiz genug, um Hochbegabte richtig zu fördern?
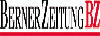
Die Jura-Frage sei geklärt, findet die Bundesrätin. Deshalb soll das Symbol wieder in seine alte Heimat zurückkehren.
Diabetes verursacht jedes Jahr Milliardenkosten. Oft behandeln Ärzte die Krankheit nicht nach aktuellen medizinischen Leitlinien. Jetzt steuert der erste Krankenversicherer dagegen – mit einem finanziellen Anreizsystem.
Professor Oliver Strijbis erklärt, warum Leute mit ausländischen Wurzeln weniger wählen gehen und in der Politik untervertreten sind.
Es ist eine Seuche: Viele Pendler parkieren ihre Füsse im Zug auf dem Sitz gegenüber. Im Sommer ziehen sie dann auch noch die Schuhe aus und verteilen ihre Fussfauna auf dem Polster.
Ein Entscheid des Bundesgerichts zu Cannabis hat laut Experten auch Folgen beim Vorgehen gegen harte Drogen. Bei den Justizbehörden ist jetzt Feuer im Dach.
Nur wenige Leute mit Migrationshintergrund gehen wählen – ausser, wenn sie in ihren Herkunftsländern mitbestimmen können. Mustafa Atici, Sibel Arslan und Sanija Ameti wollen das ändern und gehen vor den Wahlen in die Offensive.
Der glamouröseste Bundesrat der Schweiz macht zum letzten Mal das Filmfestival zu seiner grossen Bühne. Und zeigt noch einmal, wie Politik in einem Land funktioniert, in dem alle miteinander verbandelt sind.
Temperaturen von weit über 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit machen den Teenagern in Südkorea zu schaffen. Doch heimreisen wollen die wenigsten.
Viola Amherd lässt nur noch elektrische Staatskarossen anschaffen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter verzichtet auf eine eigene Limousine mit Chauffeur – um Geld zu sparen.
Gemäss den USA sollen mehrere Schweizer westliche Kriegstechnologie an Geheimdienste geliefert haben. Nach fünf Jahren Ermittlungen verurteilt der Bund nun eine Person zu einer bedingten Geldstrafe.
Italienische Gastarbeiter brachten das Mediterrane in die Schweiz – beim Essen, beim Feiern, beim Fussball. Doch der Weg dazu war nicht immer leicht, das zeigt eine Ausstellung des Landesmuseums in Zürich. Drei Zeitzeugen berichten.























