
Die Zahl der Tessiner, die wegen Covid-19 im Krankenhaus liegen, ist deutlich gesunken. Das lässt sich auf die strengen Massnahmen des Kantons zurückführen. Aber wenn man diese Vorkehrungen zu stark lockert, droht die nächste Corona-Welle.
Die Informationssendungen von SRF erreichen derzeit ein grosses Publikum. Im Leutschenbach wurde nun der erste Fall bestätigt. Der Sendebetrieb sei deswegen aber noch nicht eingeschränkt.
«Bleiben Sie zu Hause» lautet der Appell des Bundesrats. In den Jura-Hügeln zählte die Polizei aber fast nur Deutschschweizer Nummernschilder – zum Unmut der lokalen Bevölkerung, die sich diszipliniert zeigte.
Die Kraftwerke Oberhasli müssen die Erneuerung der Grimsel-Staumauer wohl aus eigener Kraft stemmen. Der Bund hat zu Recht eine Investitionshilfe verweigert. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts schärft die Subventionspraxis in der Energiewende.
Die Schweizer Steuergesetzgebung ist «weitgehend konform», mit OECD-Regeln. Zu diesem Schluss kommt das Global Forum in seinem diesjährigen Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde.
Die Behauptungen über den Nutzen von Masken gehen weit auseinander. Der Bund steht im Verdacht, den Nutzen für das breite Publikum nur wegen der Knappheit an Masken zu verneinen. Höchste Zeit für eine Analyse der Forschungsliteratur.
1985 sorgt Korpskommandant Roger Mabillard für negative Schlagzeilen in der Schweiz und in Deutschland. Ihm wird vorgeworfen, ein antidemokratisches Weltbild zu vertreten. Ein Blick zurück.
Die Entwicklungsdirektion finanziert in dem südostasiatischen Land für 16 Millionen ein Projekt für Kleinbauern. Nun stellt ein vertraulicher Bericht des Aussendepartements erhebliche Mängel fest. Die ungenügende Kontrolle ist nur ein Problem.
Nach dem zweiten Wassereinbruch bleibt eine Röhre des Lötschberg-Basistunnels noch für Wochen geschlossen. Wegen der Corona-Pandemie arbeiten nur wenige Leute im Tunnel an einem Provisorium. Eine längerfristige Sanierung muss warten.
Politiker preisen gerne die Segnungen der Digitalisierung. Doch wenn es um das eigene Haus geht, bremsen sie. Die Corona-Krise könnte sie nun zum Umdenken zwingen.
Die Bürgerlichen fordern ein baldiges Ende des Lockdowns. Bundesrat Alain Berset dämpft die Erwartungen.
Die Schweiz prüft, ob sie Rom mit Schutzmaterial unterstützen kann. Das sagt Aussenminister Ignazio Cassis. Der FDP-Bundesrat erzählt zudem, wie er die Pandemie als Tessiner wahrnimmt.
Das Coronavirus macht Polizisten zu Vermessern. Wie es für die Ordnungshüter Marco Guanziroli und Michael Schibig ist, Menschen sagen zu müssen, sie sollen doch zwei Meter Distanz halten.
Schweiz und Deutschland im Würgegriff von Corona: Welche Folgen hat die Pandemie? Der Ökonom Reiner Eichenberger spricht in «NZZ Standpunkte» über eine kontrollierte Durchseuchung, den finanziellen Kollaps, und er berechnet die Kosten eines Menschenlebens.
Gemessen an den bisherigen Opferzahlen zählt Covid-19 laut Munich Re noch nicht als eine schwere weltweite Pandemie. Bei dem Rückversicherer könnte durch die schweren wirtschaftlichen Folgen ein neues Geschäftssegment entstehen.
Als der globale Silberpreis in den 1960er Jahren ungebremst steigt, nimmt der Ansturm auf Schweizer Silbermünzen bizarre Züge an. Im März 1968 zieht der Bundesrat die Notbremse – ein Blick zurück.
Im Frühjahr 1953 sorgt ein grotesker Mordfall in Zürich über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Mit rechtsstaatlich heiklen Verhörmethoden versuchen die Ermittler, einem dringend Tatverdächtigen ein Geständnis abzuringen – ein Blick zurück.
Mit der Eröffnung des ersten grossen Einkaufszentrums des Landes beginnt vor 50 Jahren eine neue Ära im Detailhandel – ein Blick zurück.
Maschinenpistolen, Mord und Raub: Anfang der 1950er Jahre verschreckten Ernst Deubelbeiss und Kurt Schürmann die Schweiz mit brutalen Verbrechen «amerikanischen» Typs – ein Blick zurück.
Getarnt ist die Mission als humanitäre Hilfsaktion. In Tat und Wahrheit unterstützen Chirurgen und Krankenschwestern aus der Schweiz von 1941 bis 1943 die deutsche Wehrmacht.
Im Februar 1955 besetzen rumänische Antikommunisten in Bern die Gesandtschaft ihres Heimatlandes. Die Ostblockstaaten üben harsche Kritik an der Schweiz, und der Drahtzieher der Aktion wird Jahre später in eine tödliche Falle gelockt – ein Blick zurück.
Nicht alle schreien «Lügenpresse», aber viele kritisieren die Medien. Für guten Journalismus ist das eine Chance: indem er auf Glaubwürdigkeit und Dialog setzt. Denn Leser sind keine lästigen Bittsteller, sondern Partner auf Augenhöhe.
Seit 240 Jahren erscheint die «Neue Zürcher Zeitung». Ein Rückblick in 26 Buchstaben.
Der profilierte Journalist und Buchautor Gabor Steingart plädiert im NZZ-Interview für mehr Mitsprache der Leser und mehr Unabhängigkeit von der Werbewirtschaft.
Die ersten NZZ-Redaktoren sind deutsche Freigeister. Unter der Zensur produzieren sie eine subversive Zeitung. Einer nach dem anderen wird entlassen. Und was tun die arrivierten Zürcher Herausgeber des Blatts?
Sie nennen sich «alte Frauen» und provozieren damit bewusst. Die Organisation «GrossmütterRevolution» engagierte sich am Frauenstreik.
Am 14. Juni 1991 beteiligten sich Hunderttausende Frauen am ersten Frauenstreik mit dem Motto: «Wenn Frau will, steht alles still.» Der Schweizerische Gewerkschaftsbund dokumentierte den Tag mit der Videokamera. Auszüge aus dem Film: «Der Aufstand gilt dem Patriarchat».
Die Schweiz unterscheidet zwischen meldepflichtigen, bewilligungspflichtigen und verbotenen Waffen. Mit der Teilrevision des Waffenrechts ändert sich die Klassierung einiger Waffen.
Eine gute Anwältin oder einen guten Rechtsberater zu finden, ist nicht immer ein leichtes Unterfangen. Niemand weiss das besser als die Profis selbst. Ein paar Tipps, wie man die Suche erfolgreich gestalten kann.
Die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie haben weitreichende Folgen für den internationalen Handel. Verträge können nicht mehr oder nur noch unter massiv erschwerten Bedingungen eingehalten werden.
Fälle im Graubereich von Auftrag, Gefälligkeit und Geschäftsführung ohne Auftrag sind von besonderer, vor allem gesellschaftlicher Relevanz. Das erfordert eine gesetzesnahe Rechtspraxis.
Wie sich die Links-rechts-Positionierungen im Nationalrat seit dem letzten Jahr verändert haben und welche Politiker auffallen: Das interaktive Parlamentarier-Rating.
Der Schwyzer SVP-Ständerat politisiert im Rat am weitesten rechts. Die am weitesten links stehende Vertreterin der Kantone ist Liliane Maury Pasquier.
Der Parlamentsschnitt ist wieder ziemlich genau in der Mitte angekommen. Die SVP wird immer rechter, die SP wird immer linker. Zwei Jahrzehnte Nationalrat im Überblick.
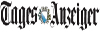
Führende Parteienvertreter stellen sich hinter den Bundesrat. Dieser müsse jetzt Szenarien entwerfen. Doch für die Kommunikation sei es zu früh.
Einkaufstourismus in Corona-Zeiten: Über 65-Jährige aus dem Tessin fahren durch den Gotthard, um ungestört ihre Einkäufe tätigen zu können.
Selbst wenn es zum totalen Stromausfall käme, hätte die Sanität der Armee noch den Überblick: In ihrer Einsatzzentrale hält sie mit Klötzen und Farbe fest, wo Soldaten Pflegerinnen und Pfleger unterstützen.
80 Jahre lang bunkerte der Bund tausende Tonnen Ethanol für den Fall einer Pandemie. Ein Jahr vor Ausbruch der Coronakrise löste das Bundesamt für Landesversorgung die Reserven auf.
Der Bundesrat will bis 16. April über mögliche Lockerungen der Corona-Massnahmen entscheiden. Die Corona-News aus der Schweiz im Ticker.
Alle erneuerbaren Heizsysteme haben gemeinsam, dass sie die CO2-Emissionen reduzieren, den Wiederverkaufswert Ihrer Liegenschaft positiv beeinflussen und langfristig die Heizkosten senken.
Die Gesuche bei den Sozialämtern steigen seit einigen Wochen stark an. «Das macht uns grosse Sorgen», sagt der Präsident der Sozialhilfekonferenz.
Die Bundespräsidentin sprach in Basel mit Vertretern der Pharmafirmen und des Universitätsspitals über die Corona-Krise. Wir berichteten im Ticker.
Die Corona-Krise trifft sozial schwache Menschen doppelt. Jetzt fordern 28 Organisationen aus der Schweiz, auch für sie zu schauen.
Der Rohstoff Ethanol ist hierzulande äusserst knapp. Nun zeigen Recherchen warum: Der Bund liess seine Pandemie-Reserve Ende 2018 auflösen.
Mittel, die Ärzte auf Intensivstationen brauchen, wenn sie Corona-Patienten künstlich beatmen, reichen zum Teil nur noch wenige Tage. Die Behörden versuchen fieberhaft, Nachschub aufzutreiben.
Der Rheintaler Stefan Kuster tritt seine Stelle beim Bundesamt für Gesundheit mitten in der Krise an.























