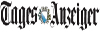
Ein politisch heikles Urteil: Das Bundesgericht entscheidet über ein umstrittenes Inserat der SVP zur Zuwanderungsinitiative.
Der Bundesrat tritt beim Klimaschutz auf die Bremse: Er will die ab 2020 europaweit geltenden Abgasgrenzwerte nur schrittweise einführen.
Die Energiewende spaltet nicht nur die FDP, sondern auch die ihr nahestehende «Neue Zürcher Zeitung». Nun verfügte der Chefredaktor eine neue Position der Zeitung.
In die Jahre gekommene Panzer, eine von der Existenz bedrohte Luftwaffe, zu wenig Soldaten – laut Philippe Rebord nur einige der Baustellen nach seinen ersten 100 Tagen im Amt.
Der Bund verteilt Asylbewerber nach dem Zufallsprinzip. Dies, obwohl französischsprachige Flüchtlinge in der Romandie schneller einen Job finden würden.
Die Verteilung nach dem Zufallsprinzip schafft für Flüchtlinge Sprachbarrieren. Politiker wollen handeln.
Integration erfolgt in erster Linie über Arbeit, entsprechend sollte man Flüchtlingen die Suche danach erleichtern, nicht zusätzlich verkomplizieren.
Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle fordert bessere Mittel, um Terrorismus zu bekämpfen. Sie betont, wie aufwendig die Jagd nach Extremisten sei.
Der Finanzminister will das Grenzwachtkorps entlasten – und verteidigt die nächtliche Schliessung von Grenzposten im Tessin.
Der US-Angriff löst keine Probleme, sagt Salah. Eine Reportage über die Reise der Familie Hussein von Athen nach Basel.
Bundespräsidentin Doris Leuthard verteidigt ihren Meinungswechsel bei der Kernenergie.
Gilbert Casasus, Professor für Europastudien in Freiburg, beurteilt den gestrigen Schweizer Tag in Brüssel positiver als die Mehrheit der Beobachter. In den Beziehungen zur EU habe ein neuer Frühling begonnen.
Die Abstimmung über die Verfassungsreform dürfte zu einer rekordhohen Stimmbeteiligung führen.
Der «Leuthard-Effekt» greift – laut der SRG-Trendumfrage würde eine solide Mehrheit die Abstimmungsvorlage annehmen.

Die Schweiz habe in der elektronischen Kriegsführung aufgeholt, sagt der neue Armeechef Philippe Rebord. Ein Angriff sei auch als Akt der Verteidigung zu sehen.
Wer ist der Direktor des Genfer Zentrums für Islam, den Frankreich des Landes verwiesen hat? In Genf wird er als doppelzüngig bezeichnet, gleichzeitig gilt Ramadan als dialogbereiter Gesprächspartner.
Der Städteverband als Co-Herausgeber neben dem Bundesamt für Statistik hat sein Augenmerk in dieser Ausgabe in besonderem Masse auf die Mobilität in den 172 grössten Schweizer Gemeinden gelegt.
Der Zytglogge-Verlag, bei dem alle Bücher von Jürg Jegge erschienen sind, stellt die Zusammenarbeit per sofort ein.
Schützenkreise drohen mit dem Referendum gegen die Verschärfungen des EU-Waffenrechts und nehmen dabei die Kündigung von Schengen in Kauf. Doch die Schweiz kann womöglich eine Ausnahme geltend machen.
Nach dem Scheitern der USR III ist es ruhig geworden um das Thema Steuern. Im Gespräch mit der NZZ wartet Finanzminister Ueli Maurer nun mit Details zur neuen Vorlage auf.
Die Post nimmt in St. Gallen im Mai den ersten von insgesamt 19 neuen Doppelstockbussen in Betrieb. Zum ersten Mal kommen die neuen Fahrzeuge aus dem Land, das man als erstes mit solchen Fahrzeugen in Verbindung bringt.
Weil Hitler-Anhänger dem Führer einen toten Juden schenken möchten, muss am 16. April 1942 in Payerne der Viehhändler Arthur Bloch sterben. Der Mord soll den Israeliten in der Schweiz Angst einjagen.
Illegale Grenzübertritte von der Schweiz nach Deutschland nehmen zu. Nun fordert der innenpolitische Sprecher der CSU «systematische Kontrollen» an der Schweizer Grenze.
Gefährdete Minderheiten wie Juden und Muslime sollen in der Schweiz künftig besser geschützt werden. Ein entsprechendes Konzept ist beim Bund in Ausarbeitung und soll Ende 2017 vorliegen.
Der Arbeitsanfall am Bundesgericht ist sehr hoch, das gilt namentlich für die Strafrechtsfälle. Das Bundesgericht erhofft sich Hilfe vom Bundesrat. Doch eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.
Die Zürcher Justizbehörden haben Vorermittlungen eingeleitet, um die von Jürg Jegge eingestandenen Fälle von sexuellem Missbrauch zu untersuchen. Ob strafrechtlich etwas hängen bleibt, ist offen.
Ascona und Lugano wollen den Kulturtourismus vermehrt zu einem wirtschaftlichen Faktor machen. Die Neat bietet hierbei neue Chancen.
Doktoranden und Postdocs sorgen für guten Unterricht an Universitäten. Sie müssen damit rechnen, dass ihr Einsatz umsonst ist. Für eine Karriere in der Forschung zählen am Ende andere Dinge.
Universitäten profitieren von jungen Wissenschaftern, die sich für guten Unterricht und eine gute Betreuung einsetzen. Die Hochschulen stehen daher in einer besonderen Verantwortung.
Tausend Assistenzprofessuren? Die Universitäten haben die originelle Forderung, die vor fünf Jahren hohe Wellen schlug, stillschweigend begraben. Nun blüht der Wildwuchs der Reformen.
An Universitäten arbeiten viele Nachwuchswissenschafter und nur wenige Professoren. Kann das gutgehen? Michael Hengartner, Präsident von Swissuniversities, und der Mittelbau-Vertreter Florian Lippke im Streitgespräch.
Dissertationen an Fachhochschulen ermöglichen neue Forschungsansätze. Die Schweiz muss wissen, ob sie darauf wirklich verzichten will.
Wenn junge Forschende den Traum einer Professur aufgeben, müssen sie hinaus auf den Arbeitsmarkt. Sie haben einiges zu bieten. Beratungsstellen helfen, verborgene Qualitäten freizulegen.
Professionalisierte Führungs- und Organisationsstrukturen an den Universitäten eröffnen ungeahnte Perspektiven – auch und gerade für den Mittelbau.
Die Schweizerische Post will bei Spezialsendungen Drohnen einsetzen. Seit Mitte März testet das Unternehmen den Einsatz in Lugano.
Wer bei Fasnacht an johlende Meuten und Saufgelage denkt, hat nicht die Basler Fasnacht vor Augen. Die «drey scheenschte dääg im Johr» werden gediegen gefeiert. Aber Vorsicht: In Basel herrschen strenge Benimmregeln!
Die Reform der Altersvorsorge steht auf Messers Schneide. In dieser Session entscheidet sich, ob das wichtige Projekt gelingt oder scheitert. SP und CVP müssen von ihren Forderungen abrücken.
Rund 200 Personen haben sich am Internationalen Tag der Frau auf dem Bundesplatz versammelt, um strickend für ihre Rechte zu demonstrieren. Die dominierende Farbe: Pink!
Die Feministinnen unserer Zeit wollen Lohngleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie wehren sich gegen Sexismus, Diskriminierung und Abbauprogramme. Gewerkschafterin Bettina Dauwalder nimmt Stellung.
Seit der Staatsgründung leisten jüdische Israelinnen Wehrdienst. Nun stossen sie vermehrt in Kaderpositionen und Kampfeinheiten vor. Daran nehmen viele Anstoss, Feministinnen ebenso wie Ultraorthodoxe.
Ausgehend von einem Baukasten für Häuser aller Art zimmert sich der Aargauer Zimmermann Josef Wernle in der Hochkonjunktur ein Imperium, das im ganzen Land Spuren und am Schluss Gläubiger hinterlässt.
Am 16. März 1986 verbucht Christoph Blocher seinen ersten aussenpolitischen Abstimmungserfolg – dank sowjetischen Geheimpolizisten in Genf und halbherzigen Gegnern. Ein Blick zurück.
Als die Tochter des blutrünstigen «roten Zaren» 1967 in die USA flüchtete, wurde sie zur berühmtesten Überläuferin des Kalten Krieges. Die Schweizer Diplomatie spielte dabei eine zentrale Rolle.
Die Schweiz steht im März 1997 wegen ihrer Weltkriegsvergangenheit unter argem Beschuss. Da wagt der Bundesrat eine grosse Idee – die aber einem kleinlichen Verteilkampf nicht gewachsen sein wird.
Was hat die Schweiz damals nur geritten? Im Kalten Krieg streitet sie monatelang über die Notwendigkeit von Militärpferden.
Punk in Wolfenschiessen, ein Schwingfest für Künstler im Garten eines Skistars: In den 1980er Jahren machen spätere Kulturgrössen wie Stephan Eicher ihre ersten Gehversuche.
Der Kriegsverbrecher Josef Mengele nutzte die Schweiz zeitweise als Stützpunkt für Kontakte mit seiner Familie in Günzburg. Gefasst wurde er dennoch nicht.
Nigerias Krieg gegen das abtrünnige Biafra weckt in der Schweiz Emotionen und Hilfsbereitschaft. Die humanitären Aktionen werden zum Lehrstück.
Nach einer wilden Schiesserei auf Grenzwächter wird der berüchtigten deutschen Linksterroristin Gabriele Kröcher-Tiedemann der Prozess gemacht. Ihr Leben endet tragisch – trotz Läuterung.
Südafrikas Apartheidregime sah sich Mitte der achtziger Jahre endgültig in die Ecke gedrängt. Unangenehm wurde es aber langsam auch für die Schweiz, die mit ihm vergleichsweise freundlich verkehrte.
Vor 25 Jahren begann der Bosnienkrieg, der 100 000 Tote forderte und 2 Millionen Menschen in die Flucht schlug. 24 000 von ihnen landeten in der Schweiz, wo viele bis heute leben.
Seit 2002 wird im Kanton Luzern überall gespart. Vor allem die Sparmassnahmen bei der Bildung sorgen immer wieder für Proteste. Auch heute gingen Lehrer und Schüler auf die Strasse. Am Nachmittag solidarisierten sich die Schüler landesweit.
In der Ausstellung im Landesmuseum wirkt das Pult, an dem Lenin nächtelang arbeitete, etwas verloren. Dabei erzählt es so manche (Zürcher) Geschichte.
Die Beschäftigung im öffentlichen Sektor hat in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Ihr Wachstum ist aber nicht die grösste Bedrohung für den Staatshaushalt.
Die Ausgaben für Gesundheit und Bildung wachsen weiter, der Personalbestand in diesen Sektoren nimmt zu. Die Herausforderung besteht darin, gut ausgebildetes Personal zu finden.
Angesichts knapper Finanzen kommt auch das Bildungssystem unter Druck: Wieso etwa steigt die Zahl der Beschäftigten in Erziehung und Unterricht immer weiter, obwohl die Schülerzahlen gesunken sind?
Das Parlament wollte das Bundespersonal auf 35 000 Stellen begrenzen. Doch bei der Umsetzung dieses Entscheids hat sich der Bundesrat ein paar Hintertüren offengelassen.
Nicht nur im Gesundheits- und Sozialwesen dehnt sich der staatsnahe Sektor stark aus, sondern auch die öffentliche Verwaltung wächst. Gleichzeitig sinkt – anders als im privaten Sektor – die Produktivität. Ökonomen sind besorgt.
Trotz Masshalten steigt die Zahl kantonaler Angestellter weiter. Diese sehen sich Nullrunden bei den Löhnen und neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung ausgesetzt.
Verlässliche Daten über die Personalentwicklung in den 26 kantonalen Verwaltungen gibt es nicht. Jeder Kanton tickt anders, auch verändern sich die Grundlagen der Datenerhebung.
Pirmin Schwander ist der Rechtsausleger im Nationalrat, Lisa Mazzone die Linkste – und CVP-Fraktionschefin Viola Amherd die personifizierte Mitte. Die zentralen Erkenntnisse des Parlamentarier-Ratings im Überblick.
Der Freisinn profitiert von der Stärkung des rechten Lagers im Nationalrat – der SVP nützt ihr Wahlsieg von 2015 hingegen kaum. Für die Linke sind harte Zeiten angebrochen.
Die CVP zieht in der kleinen Kammer an einem Strick – dafür ist die SP weniger geschlossen als im Nationalrat. Daniel Jositsch ist auch im Stöckli der rechteste Sozialdemokrat.
Romands politisieren anders als Deutschschweizer, Nationalrätinnen anders als ihre männlichen Kollegen: Das zeigt das NZZ-Parlamentarier-Rating.
Einst haben die Zürcher Fahnenträger die nationale SVP auf strammen Rechtskurs getrieben. Die heutige Zürcher Delegation ist innerhalb der Fraktion ziemlich eingemittet. Dünner ist Zürich auch am rechten Flügel der SP vertreten.
Die erstarkende SVP zieht den Parlamentsschnitt nach rechts. Die SP wird immer linker. Die Grünen pendeln an den Rand und zurück. Zwei Jahrzehnte Nationalrat im Überblick.
Ein Ja zur Energiestrategie 2050 am 21. Mai 2017 ist ein gesellschaftlicher Gewinn, denn es bringt verlässliche Rahmenbedingungen für Industrie und Gewerbe.
Die Energiestrategie schreibt den Atomausstieg ins Gesetz. Tatsächlich ist er bereits vollzogen. Die Politik hinkt der Realität in der Regel hinterher.
Der Branchendachverband bekämpft aktiv die Energiewende. Im Unterschied dazu verzichtet Interpharma auf eine Stellungnahme. Roche und Novartis betonen derweil ihr ökologisches Engagement.























