
Soll der Bund den Kantonen Geld geben für billigere Krippenplätze? Diese Frage hat der Ständerat nicht beantwortet - zumindest darüber reden will er aber.
Am Montag hat sich die Mehrheit des Nationalrats gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgesprochen. Nun müssen sie die Konseqenzen daraus ziehen.
Nach dem Nein zur Ausstiegsinitiative wird hinter den Kulissen über verschiedene Varianten zum langfristigen Betrieb der Kernkraftwerke diskutiert. Entscheidend wird die Haltung der CVP sein.
Der Nationalrat will keine Aufweichung der Schuldenbremse. Das ist im Prinzip erfreulich, doch den Tatbeweis tugendhafter Finanzpolitik muss das Parlament bei den konkreten Budgetentscheiden liefern.
Die Nationalstrasse A 4 soll im Abschnitt Schaffhausen für 473 Millionen Franken ausgebaut werden Der Bund legt ein Projekt mit einer zweiten Röhre durch den Fäsenstaubtunnel vor.
Der Nationalrat hat am Montag eine Motion angenommen, die eine Aufweichung der Schuldenbremse verhindern will.
Während sich die SVP bei Majorzwahlen weiterhin schwertut, bringt die CVP ihre Kandidaten meist problemlos durch. Doch langsam, aber sicher ziehen für die CVP dunkle Wolken am Horizont auf.
Der Zürcher SVP-Politiker Jürg Stahl ist höchster Schweizer. Der Nationalrat hat den 48-Jährigen zu Beginn der Wintersession zum Präsidenten gewählt.
Ivo Bischofberger ist neuer Ständeratspräsident. Er wurde am Montag mit 43 von 43 gültigen Stimmen gewählt. Der 58-jährige CVP-Politiker ist erst der dritte Innerrhödler in diesem Amt.
Seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative profilieren sich die Parteien durch Kehrtwenden und Ablenkungsmanöver. Jetzt naht die Stunde der Entscheidung. Eine Auswahl der schönsten Pirouetten der letzten drei Jahre.
Die FDP will die Schweiz fit machen für die vierte industrielle Revolution. Die Hauptaufgabe des Staates dabei: Nur ja nicht bremsen.
Wer wandert in die Schweiz ein? Dringend benötigte Ärzte und Ingenieure? Eine Zürcher Studie zeigt, dass nur jeder fünfte Zuwanderer in einem Beruf arbeitet, wo ein Mangel an Fachkräften herrscht.
Wer in den 1960er Jahren über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg forschen wollte, bekam keinen Archivzugang. Zwei Studenten sind daraufhin eigene Wege gegangen – mit nachhaltigem Erfolg.
Die einen freut's, die anderen reut's: Während Alec von Graffenried von der Grünen Freien Liste den Einzug in die Berner Stadtregierung schaffte, verpasste der FDP-Finanzdirektor Alexandre Schmidt die Wiederwahl.
Die Schweiz stimmt gegen das rasche Ende der AKW – klar und landesweit. Das Nein ist so deutlich, weil sich Gegner und Befürworter der Energiestrategie 2050 kumulierten. Doch nach geschlagener Schlacht streben sie bereits wieder auseinander.
«Halbherziges Nein», «deutliches Nein» oder gar «Abfuhr»? Die Zeitungskommentaren sind sich nicht einig, wie die 54 Prozent Nein-Stimmen einzustufen sind.
Die Atomausstiegsinitiative der Grünen ist an der Urne deutlich verworfen worden. Ins Zentrum der Debatte rückte noch am Abstimmungssonntag die Energiestrategie 2050.
Das Nein zur Atomausstiegsinitiative ist ein Vertrauensbeweis, aber kein Blankocheck. Soll die Energiewende gelingen, braucht es noch viel Überzeugungsarbeit.
Wie ist das deutliche Nein zur Atomausstiegsinitiative zu erklären? Und was bedeutet es für die Energiestrategie 2050 des Bundes? NZZ-Inland-Redaktor Helmut Stalder sieht das Ergebnis als Auftrag für eine Energiewende mit Augenmass.
Die Berner Stadtkanzlei reicht eine Strafanzeige wegen Wahlbetrugs ein. 300 Wahlzettel wiesen die gleiche Handschrift auf. Davon betroffen ist eine Partei.
Das Schweizer Stimmvolk hat die Atomausstiegsinitiative der Grünen klar abgelehnt. Als Verlierer will sich aber niemand sehen.
Selten hat eine helvetische Bildungsreform die Gemüter derart erhitzt wie der Lehrplan 21. Längst ist das Projekt zum politischen Zankapfel und zur pädagogischen Glaubensfrage emporstilisiert worden.
Kompetenzorientierung, internationale Bildungsstandards und Schweizer Harmonisierungsbestrebungen: Der Lehrplan 21 polarisiert. Christian Amsler und Alain Pichard kreuzen die Klingen.
Die Erziehungswissenschaft hofft, dass der «kompetenzorientierte Unterricht» die Kinder fit für das Leben macht. Kritiker dagegen reden vom Tod der Bildung. Aber was heisst «Kompetenz» eigentlich?
Die Schweiz und Frankreich feiern am Dienstag den 500. Jahrestag des Friedensvertrags von Freiburg, den «Ewigen Frieden». Wie friedlich ist es entlang der Grenze wirklich? Eine Reise von Basel nach Genf.
Die Eidgenossenschaft und Frankreich feiern am Dienstag den 500. Jahrestag des Friedensvertrags von Freiburg, den sogenannten Ewigen Frieden. Impressionen einer Grenztour von Basel nach Genf.
1516 – im Jahr 1 nach Marignano – wurde in Freiburg der «Ewige Frieden» zwischen der Eidgenossenschaft und dem französischen König geschlossen. Er hatte für die Schweiz nachhaltige Folgen.
Der sagenhafte Teufelsstein von Göschenen steht dem Bau des Gotthard-Strassentunnels im Weg und soll daher gesprengt werden. Doch die Urner opponieren und retten 1973 den Klotz – nicht zum ersten Mal.
Mit der Verhaftung von Raphael Huber begann vor 25 Jahren die Zürcher Wirte-Affäre. Die Justizposse ist auch ein Abbild der streng regulierten Zürcher Gastroszene der 1980er Jahre.
Im Spätherbst 1907 feiern die Urkantone und Studenten 600 Jahre Eidgenossenschaft. Obwohl das Datum stark umstritten ist, markiert der Bundesrat mit einer hochkarätigen Delegation Präsenz in der Innerschweiz.
1986 brennt es auf dem Industriegelände Schweizerhalle. Tonnen von Chemikalien landen im Rhein: eine riesige Umweltkatastrophe. Dafür wird das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung gestärkt.
Der «Blick» ist das erste richtige Revolverblatt der Schweiz. Bei seiner Lancierung im Oktober 1959 löst er heftige Proteststürme aus. Gekauft wird die Zeitung trotzdem.
1939 gelingt es Schweizer Fluchthelfern, ein Schiff für 460 Flüchtlinge von Italien nach Palästina zu organisieren. Ernst Prodolliet, Vizekonsul in Bregenz, stellt die illegalen Visa aus.
Nach der Französischen Revolution setzte sich auch in der Westschweiz das Französische gegen die Mundart durch. Der am 3. Oktober 1954 im Wallis gegründete Patois-Förderverein läutete ein Revival ein.
An der nationalen Leistungsschau in Genf werden mehr als 200 Westafrikaner ausgestellt. Der zur Volksbelustigung gedachte Menschenzoo offenbart einen dumpfen Rassismus – ein Blick zurück.
Im Haus der Jugend finden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen Zufluchtsort. Für Unterkunft, schulische Betreuung und Verpflegung ist gesorgt. Doch nicht für alles ist es ein Ersatz.
Sanieren oder ersetzen: Das war die Frage, als eine Untersuchung 2006 den schlechten Zustand des Albualtunnels ans Licht brachte. Die Rhätische Bahn entschied sich für letzteres. Seit August 2015 arbeiten die Mineure im Berg zwischen Preda und Spinas.
Wrestling ist in den USA ein Millionengeschäft – und in der Schweiz? Eher Dorftheater. Ein Abend unter Wrestlern im Sternensaal Bümpliz.
Die Eidgenossenschaft und Frankreich feiern am Dienstag den 500. Jahrestag des Friedensvertrags von Freiburg, den sogenannten Ewigen Frieden. Impressionen einer Grenztour von Basel nach Genf.
Die Caritas will Flüchtlingskindern aus Afghanistan, Eritrea, Somalia und Syrien im Haus der Jugend ein normales Umfeld bieten. Für Unterkunft, schulische Betreuung und Verpflegung ist gesorgt. Doch zu einem Zuhause gehört viel mehr.
Sanieren oder ersetzen: Das war die Frage, als eine Untersuchung 2006 den schlechten Zustand des Albulatunnels ans Licht brachte. Seit August 2015 arbeiten die Mineure im Berg zwischen Preda und Spinas an einem Neubau.
1515 mussten sich die Eidgenossen in der Schlacht bei Marignano den Franzosen auf das bitterste geschlagen geben. Die Niederlage gilt als markanter Wendepunkt in der Schweizer Geschichte – und als profitabelste.
Die Energiewende bewegt die Schweiz. Derzeit im Zuge der Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative am Sonntag. Doch woher bezieht die Schweiz ihren Strom? Und welche Veränderungen erwarten das Land mit der Energiewende?
Im neuen Albulatunnel bereiten Ingenieure seit Monaten den Durchstoss eines Abschnitts mit besonders porösem Gestein vor. Im alten Tunnel, der nur 30 Meter parallel zum Neubau verläuft, kam es vor über 100 Jahren an gleicher Stelle zu einem folgenschweren Unglück.
Der überprüfbare Inhalt eines bis dahin unbekannten FBI-Dokuments decke sich mit seiner langjährigen Forschung – deshalb erachtet es der deutsche Terrorexperte Wolfgang Kraushaar für glaubhaft.
Ein FBI-Bericht lässt den Bombenanschlag von 1970 auf ein Swissair-Flugzeug in neuem Licht erscheinen: In der palästinensischen Terrorgruppe sollen auch zwei Westdeutsche aktiv mitgewirkt haben.
Laut einem Untersuchungsbericht finden sich in den Akten der Bundesanwaltschaft keine Hinweise, dass das Strafverfahren zum Würenlingen-Attentat von 1970 nicht gesetzmässig durchgeführt worden ist.
Vertiefte Recherchen der Verwaltung bringen keine Hinweise auf ein Geheimabkommen. Die Geschäftsprüfer vertrauen darauf. Derweil untersuchen sie die Sistierung des Lenkwaffenprojekts Bodluv.
Als 20-Jähriger lauschte er im Sommer 1970 höchst vertraulichen Gesprächen zwischen seinem Vater und Bundesrat Pierre Graber: François A. Bernaths Erinnerungen bergen Zündstoff.
Der Bericht der behördlichen Arbeitsgruppe zur Causa Graber/PLO ist als Zwischenbilanz nützlich. Er kann aber nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachtet werden.
Der Schlussbericht wirft Fragen auf, mit denen sich auch die GPK noch befassen dürfte. Jean Ziegler hält die Resultate der Arbeitsgruppe für «irrelevant», und Buchautor Gyr hält an seiner These fest.
Die Kantone Thurgau und Schaffhausen bescheren den Gegnern des Lehrplans 21 veritable Schlappen: Ihre Initiativen, mit denen sie die Lehrpläne vors Volk bringen wollten, werden deutlich verworfen.
Was alle Kinder in der Schule lernen sollen, wird seit der Schaffung «moderner» Schulsysteme im 19. Jahrhundert durch die Kantone festgelegt. Das wichtigste Mittel dafür war und ist der Lehrplan.
Noch nie war so viel von Kontrolle und Steuerung im Bildungswesen die Rede wie heute. Aus pädagogischer Sicht ist die marktförmige Instrumentalisierung der Schule längerfristig ein Fehler.
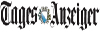
Das Genfer Modell dient Unterstützern eines Inländervorrangs als Vorbild. Als solches lobt es auch die Kantonsregierung – doch das Urteil von Wirtschaft und Gewerkschaften fällt kritisch aus.
Das Vorzimmer des Ständerats war der einzige Zugang zur «Dunkelkammer». Jetzt gibt es den Eintritt nur noch auf persönliche Einladung.
Mit einem Wähleranteil von gut 61 Prozent holt Rot-Grün vier von fünf Sitzen in der Berner Stadtregierung. Jetzt fragt man sich: Ist das noch demokratisch?
Die Mehrheit des Nationalrats hält das Stabilisierungsprogramm für nötig. Seit Jahren würden Überschüsse verzeichnet und gleichzeitig Sparpakete geschnürt, argumentieren die Gegner.
Der Berner Wahlfälscher hatte eine Vorliebe für Erich Hess. Stadtschreiber Jürg Wichtermann sagt, wie die versuchte Wahlfälschung aufgeflogen ist.
Die FDP ringt um ihren Kurs in der Energiestrategie 2050. Präsidentin Petra Gössi bestreitet, dass ihre Partei gespalten sei und ihre Parteikollegen käuflich seien.
Der Nationalrat hat den 48-jährigen Zürcher SVP-Politiker Jürg Stahl zum Präsidenten gewählt. Für den ehemaligen Turner gab es eine spezielle Show.
Der 58-jährige Historiker ist zum Ständeratspräsidenten gewählt worden. Der CVP-Politiker ist erst der dritte Innerrhödler in diesem Amt.
300 ungültige Wahlzettel in Bern werden ein Fall für die Justiz. Die Berner SVP hat nun ebenfalls Anzeige eingereicht.
Auf der Flucht seien Frauen und Mädchen permanent von Gewalt und sexuellem Missbrauch bedroht, klagt eine Hilfsorganisation. Sie fordert Änderungen am Schweizer Asylverfahren.
Viele Verteiler ignorieren den Sticker gegen Reklame an Briefkästen. Illegal ist das nicht, wie eine konkrete Aktion zeigt.
Nach dem Nein zur Atomausstiegsinitiative sucht die Volkspartei Unterstützung für ihr Referendum.
Bei den Wahlen in Bern wurden Unregelmässigkeiten festgestellt. Die Stadt hat Strafanzeige eingereicht.
Das VBS möchte ein Debakel wie bei der Gripen-Abstimmung unbedingt verhindern. Aber einen zentralen Aspekt lässt es ausser Acht.























