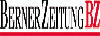
Welche Rolle spielt Geld im Leben? Sechs Menschen im Rentenalter über ihre kurvigen Lebensläufe, Bescheidenheit – und Teppiche als kleinen Luxus.
Denis Riffel verkörpert bei den Thunerseespielen den Glöckner von Notre-Dame. Im Interview spricht der 29-Jährige über Ausgrenzung, Empathie und seinen grössten Rollenwunsch.
Stefan Leins hat während zwei Jahren auf einer Zürcher Grossbank gearbeitet – als Forscher. Er erzählt, wieso der Erfolg von Analysten gar nicht so sehr auf Zahlen basiert und was die Banken unterschätzen.
Jeden Tag erreicht die Berner Zeitung eine Vielzahl an Leserbildern. Eine Auswahl der schönsten Fotos finden Sie hier.
Der britische Pop-Gigant brachte seine bisher grösste Show nach Zürich. Dabei trug er ein Schweiz-Liibli – und schenkte dem Publikum eine Weltpremiere.
Lässt Ihr Sprachgefühl während der Ferien oder bei hochsommerlichen Temperaturen nach? Testen Sie es!
Nachdem er Nazi-Deutschland verlassen musste, geriet der Hamburger Fotograf in Vergessenheit. Nun kann Halberstadts Vielseitigkeit wieder entdeckt werden.
Das Schloss Spiez widmet sich in seiner aktuellen Schau ausschliesslich der Kunst von Frauen. Darunter: Marguerite Frey Surbek, Margrit Linck und Martina Lauinger.
Israel kritisiert die Verbreitung von Fotos eines palästinensischen Kindes mit Gendefekt. Soll man solche Bilder zeigen oder nicht? Das sagt die Medienethikerin.
Ausserdem: ein krasses Trinkgeld, problematisches Sexspielzeug und Funfacts für Mücken-Nerds. Wir wünschen ein angeregtes Tischgespräch.

Der Putsch vom Oktober 1917, den die Bolschewiki später als «Grosse Sozialistische Oktoberrevolution» verklärten, stürzte Russland in ein blutiges Chaos. Wladimir Lenin setzte mit grosser Grausamkeit eine neue politische Ordnung durch.
Andere Staatschefs wirken im Vergleich zum US-Präsidenten wie Chargen im Provinztheater. Das zeigt sich jetzt wieder im Zollstreit.
Warum nicht die Autobahn auf der Fahrt Richtung Süden für einen kunstsinnigen Abstecher verlassen? Im Bündner Bergdorf Soazza ist Kunst zu entdecken, wo man sie nicht erwartet: an einer Hausfassade, vor dem Friedhof, bei der Kirche. Für Arte Soazza im Misox haben zehn Kunstschaffende Werke vor Ort gemacht.
Er hatte Kunst und Architektur studiert und schaffte Wunder auf den internationalen Bühnen. Am Donnerstag ist der amerikanische Theatermagier Robert Wilson 83-jährig gestorben.
In seinen Gedichten ging der Wiener Dichter der Sprache, dem engstirnigen Denken und der eigenen Not an den Kragen. Seine seelischen Abgründe verwandelte er in grandiose Dichtung.
Georg Diez sucht in den neunziger Jahren nach den Ursachen für die Krisen von heute, Matthias Heine zeigt, wie Wokeness die Sprache verbiegt, und Susanne Beyer fragt sich, warum ihr Grossvater in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erschossen wurde.
Eine internationale Filmcrew wagt sich an die Sage um Wilhelm Tell heran. Das Ergebnis ist sehr blutig und ziemlich blutleer.
Mädchen würden nur noch Strassenschilder lesen und ihre psychischen Störungen seien für viele wie Trophäen, klagt die deutsche Autorin. Wie kommt sie zu einem so negativen Befund?
Fünf neue Werke, die uns besonders gefallen haben. Die zum Lesen und Diskutieren inspirieren.
Der Nazikriegsverbrecher verbrachte in jungen Jahren ein paar Monate bei der Familie eines jüdischen Geschäftsmanns in Kopenhagen. Angesichts der Judenverfolgung erinnerte sich dieser an ein höfliches Versprechen des deutschen Gasts.
Gibt es eine Lösung, wenn man alle Konfliktparteien einfach in einen Bunker sperrt? Wie gehen die Opfer mit den Folgen von Willkürherrschaft um? In Salzburg ringt man diesen Sommer so intensiv wie lange nicht mit politischen Fragen.
Im Berner Oberland sorgten Wanderer in Wehrmachtsuniformen für Aufruhr. Sie hätten bloss ein Reenactment gemacht, liessen sie später verlauten. Über das Nachstellen der Vergangenheit und die Spielregeln, die dabei gelten.
Was geschieht, wenn Russland den Krieg gewinnt? Dann wird Putin, berauscht vom Erfolg, die heisslaufende Kriegsmaschinerie weiterlaufen lassen. Nur: wohin, fragt sich der Schriftsteller Sergei Gerasimow.
Die Nachkommen der Sklaven in den USA hatten einst eine doppelte Identität, was sich im Begriff «African American» zeigt. Intellektuelle wie John McWhorter fordern heute, auf diesen zu verzichten.
Ein Mann möchte schlafen, drei Frauen haben keine Lust, ihre Lautstärke anzupassen. Statt ruhig werden sie handgreiflich. Die Geschichte einer Eskalation, bei der eigentlich nur noch erstaunt, dass sie nicht öfter passiert.
Sieghörtners haben ein Haus, zwei jugendliche Töchter und vier Smartphones. Wie geht die Familie mit diesen kleinen Geräten um, die dauernd Aufmerksamkeit verlangen? Und welche Ratschläge haben Sucht- und Medienexperten?
Verglichen mit der Antike und dem Mittelalter sind gegenwärtige Debatten oft primitiv und zielen auf die Charakterhinrichtung des Opponenten. Eine Rückbesinnung auf den Wettbewerb der Ideen täte not.
Über drei Jahrzehnte lang hegte Europa die Erwartung, Krieg sei ein Auslaufmodell. Nun ist er zurück, und es zeigt sich: Regeln gelten nur so lange, wie eine Autorität bereit ist, sie durchzusetzen.
Mittagessen mit dem Gitarristen und Sänger der Kruger Brothers, der seit dreissig Jahren in North Carolina zu Hause ist. Der Star der Bluegrass-Szene erzählt vom Leben in den ländlichen USA, das ganz anders sei, als man es sich hier vorstelle.
Auf die Komödie «Happy Gilmore» von 1996 folgt knapp dreissig Jahre später ein Sequel. Adam Sandlers neue Golfer-Komödie lebt vom Wiederkäuen der Figuren und Dialoge.
In der Sommerkomödie von Oliver Rihs spielt Berlin die Hauptrolle. Vielmehr als Stereotypien zu verlachen, tut der Film dann auch nicht.
Der französische Spielfilm von Caroline Poggi und Jonathan Vinel ist eine intime Tragödie, die sich sowohl in einem Online-Spiel als auch in der realen Welt abspielt.
Raynor Winn wurde mit einem Buch über ihre Obdachlosigkeit reich, Gillian Anderson spielt sie brillant in der Verfilmung von «The Salt Path». Doch nun wurden Vorwürfe erhoben: Die wahre Geschichte soll teilweise erfunden worden sein.
Lena Dunhams neue TV-Serie «Too Much» scheitert genau daran: Sie will zu viel und landet eben darum auf dem ausgetretenen Pfad zur altbekannten Romcom-Glücksphantasie.
Aus der Verbannung zum Volkshelden: Vor 100 Jahren wurde der griechische Komponist, Freiheitskämpfer und Aktivist Mikis Theodorakis geboren.
Der Regisseur Matthias Davids befreit Wagners Komödie um falsche Kunst und wahre Liebe vom Deutungsballast – das bekommt dem Werk bestens. Etwas mehr von dieser spielerischen Leichtigkeit wünscht man den Richard-Wagner-Festspielen im Ganzen.
Rocker wie Ozzy Osbourne verbargen ihre Triebe und Spleens nicht. Sie machten sie zum Produkt.
Mit Neuproduktionen von Mozarts «Don Giovanni» und Gabriel Faurés «Pénélope» feiern die Münchner Opernfestspiele ihr 150. Bestehen. Was ist die Bilanz?
Er hat das Zürcher Kammerorchester geprägt und die Interpretation von klassischer Musik revolutioniert. Nun ist der britische Dirigent Sir Roger Norrington gestorben.
Wie ein Täterland sich einen Opfermythos schuf.
Am 8. Mai kapitulierte Hitler-Deutschland offiziell. Doch bis Ende Mai fanden im letzten Regierungssitz noch Kabinettssitzungen statt. Gerhard Paul erzählt die Geschichte des «Dritten Reiches» über das Kriegsende hinaus.
Die Schlacht von Stalingrad im Winter 1942/43 war ein geschichtlicher Wendepunkt: Sie störte die nationalsozialistische Tötungsmaschinerie und brachte sie letztlich zum Einhalt.
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Der deutsche Historiker Norbert Frei sagt, wie die Transformation des Nazistaats gelang – und wie er die Gefahr eines neuen Faschismus einschätzt.
Vor fünfzig Jahren dokumentierten weissrussische Schriftsteller Kriegsverbrechen, die die Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs begangen hatte. Jetzt erscheint der Bericht erstmals auf Deutsch.
Sie alle waren in Kalifornien im Exil: Franz Werfel, Bertolt Brecht, Heinrich und Thomas Mann und Berthold Viertel. Mitsamt ihren Ehefrauen, von denen meist weniger die Rede ist.
Jubelnde Massen, willige Erfüllungsgehilfen: Das ist das Bild, das man vom «Dritten Reich» hat. Peter Longerich vertritt in seinem neuen Buch die These, die meisten Deutschen seien keine überzeugten Nazis gewesen, sondern Konformisten.
Das Deutsche Reich lag in Scherben, das Ende des Zweiten Weltkriegs war nur noch eine Frage der Zeit. Und Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, verhandelte in Österreich über eine Nachkriegsregierung.
Marco Overhaus analysiert die neuen weltpolitischen und militärischen Voraussetzungen seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit.
Der Historiker Stephan Lehnstaedt gibt erstmals einen Überblick zum jüdischen Kampf gegen den Holocaust. Das Bild der wehrlosen Opfer muss revidiert werden.
Eine britische Schriftstellerin verkauft ihren neuen Roman mit dem Hinweis, er sei «human written», von menschlichem Geist ersonnen und geschrieben.
Der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov gedenkt auf bewegende Weise seines Vaters. Zwar stirbt dieser als «Held am Ende dieses Buches», und doch ist es «kein Buch über den Tod, sondern über die Sehnsucht nach dem Leben, das fortgeht».
Mit Chat-GPT trat Sam Altman die KI-Revolution los. Zwei Bücher gewähren neue Einblicke in seinen Werdegang und zeichnen ein vielfältiges Porträt des Unternehmers.
Stephan Balkenhol ist ein deutscher Bildhauer von Weltrang. Seine Skulpturen laden die Betrachter ein, über sich selbst nachzudenken. Für die NZZ hat er nun eine eigene Kunstedition geschaffen.
Esther Mathis ist in den letzten Jahren aufgefallen mit poetischen Werken, in denen oft physikalische Erkenntnisse mitschwingen. Für die NZZ hat sie nun die Farbtöne von Gewitterstürmen in ebenso reduzierten wie reizvollen Objekten gebannt.
Für Katharina Grosse kann alles zum Bildträger werden. Sie bemalt nicht nur Leinwände, sondern auch Wände, ganze Räume und Fassaden. Neuerdings nützt sie auch gebogenes und gewalztes Aluminiumblech als «Unterlage» für ihre genauso überlegte wie spontane Malerei in starken Farben.
Auf einem grossen Tisch liegen Materialmuster und Zeichnungen, rundherum wimmelt es von riesigen Leinwänden in leuchtenden und vibrierenden Farben, die teilweise noch auf ihre Fertigstellung warten. Wer das Studio von Renée Levi und ihrem Partner Marcel Schmid besucht, taucht augenblicklich in ein sinnliches künstlerisches Universum ein.
Die Werke der modernen Grossmeister kamen damals frisch aus den Ateliers. Heute sind einige Bilder zerstört oder verschwunden: Rekonstruktion einer legendären Ausstellung im Kunstmuseum Luzern.
Für das italienische Provinzmuseum ist es ein Happy End: Es hat sein Gemälde des Renaissancemalers Antonio Solario wieder. Die Besitzerin in England hingegen ging leer aus. Denn das Bild war gestohlen.
Sein Minimalismus zielt auf die Urform: das aus drei Quadern bestehende Tor. James Licini bestand immer darauf, Stahlbauer zu sein, nicht Künstler. Nun ist der Schweizer Eisenplastiker im Alter von 88 Jahren gestorben.
In Stommeln bei Köln verleiht ein Werk des deutschen Künstlers Olaf Nicolai dem Kultraum einer Synagoge eine Stimme: Darin geht es um Flugbahnen von Brieftauben.
Londoner Sommer-Hype um den japanischen Künstler – die grosse Schau in der Hayward Gallery.
Karl Kraus hielt «Die letzten Tage der Menschheit» für unspielbar. Nun wird sein vielstimmiges Drama an den Salzburger Festspielen gezeigt. Die Inszenierung überzeugt nur bis zur Pause.
Die Balletttänzerin wurde als Mädchen geboren, ordnet sich aber nicht eindeutig einem Geschlecht zu. Wenn sie tanzt, interessiert das niemanden: Mit ihrer Hingabe begeistert sie das Publikum. So muss es sein.
Gekürzte Subventionen, eine missglückte Opernpremiere: Lilli Paasikivis Start als Intendantin der Festspiele lässt Luft nach oben.
Was Stephen Colbert mit seiner Late-Night-Show passiert ist, kam in der Vergangenheit auch beim Schweizer Fernsehen vor: Man setzt erfolgreiche, aber oft besonders kritische Journalisten ab.
Die Plattform PI.FYI ist in der digitalen Welt, was das Biogemüse im Supermarkt ist. Sie nährt den Glauben an die Selbstbestimmung.
Mit der Einstellung der Printausgabe von «20 Minuten» endet ein Vierteljahrhundert Schweizer Zeitungsgeschichte. Der persönliche Rückblick eines Beteiligten.























