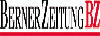
Von der Fotorestauratorin über die Historikerin zur Künstlerin: Wir zeigen drei Profis, die mit dem Medium arbeiten, aber nicht selbst auf den Auslöser drücken.
Nach den Budgetkürzungen im Kunstbereich durch die Trump-Regierung fordert das Mauritshuis in Den Haag Garantien für die Sicherheit von Kunstwerken.
Nemo ist gegen eine Teilnahme Israels am ESC. Die Handlungen des Staates stünden im Widerspruch zu den Werten des Eurovision Song Contest.
Jeden Tag erreicht die Berner Zeitung eine Vielzahl an Leserbildern. Eine Auswahl der schönsten Fotos finden Sie hier.
Berns Vierspartenhaus muss sein Programm verschlanken. Zudem wurde die Art der Spielplangestaltung geändert. Wie das funktioniert, erklärt Intendant Florian Scholz.
Demnächst im Rampenlicht: Grosswildjäger, Meerjungfrauen und ein Tanz um den Urknall.
Für die Bauwerke auf Zeit gibt es keine baulichen Bestimmungen. Das ist eigentlich gut so – und doch könnten einige wenige Regeln Verbesserung schaffen.
Er holte Stars wie Madonna und Al Pacino vor die Kamera, zuletzt inszenierte er «Fifty Shades of Grey»-Folgen. Jetzt ist James Foley 71-jährig gestorben.
Auch in Zügen und Bussen leiden wir unter der Negativitätsverzerrung. Was da im ÖV zur morgendlichen Rushhour abgeht, ist doch herzallerliebst.
Leben, Tod und Bürokratie: Der Wiener Schauspieler spricht über seine neue schwarzhumorige Serie «Drunter und Drüber» – dabei switcht er auch mal ins Schweizerdeutsche.

Margot Friedländer ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 103 Jahren, wie die Margot Friedländer Stiftung mitteilt.
Zur Durchsetzung der Weltrevolution setzte die Sowjetunion ungeniert Gewalt ein. Was sie nicht daran hinderte, ständig das Wort «Frieden» im Mund zu führen. Sie stand in der alten russischen Tradition, sich als Vollstrecker einer historischen Mission zu sehen. Auch Putin teilt sie.
Der St. Galler Sänger Manuel Stahlberger hat im Zürcher «Kaufleuten» sein neues Album vorgestellt. Seine lakonischen und ironischen Texte über Endzeitängste kontrastieren mit üppigen Sounds.
Ausgegrenzt, eingeschüchtert und gemobbt: In einem Untersuchungsbericht der Harvard University erzählen jüdische Studierende, welchen Repressionen sie ausgesetzt waren. Vielen.
Zum dritten Mal findet der ESC in der Schweiz statt. Der bunte, kuriose Gesangswettbewerb gastiert ab Sonntag in Basel. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Grossanlass.
Kultursenator Chialo galt bei seiner Amtseinführung vor zwei Jahren als Lichtgestalt. Nun ist er an sich selbst und den Umständen gescheitert.
Mit ihren exorbitanten Zöllen auf chinesische Waren lassen es die USA auf einen schwer kontrollierbaren Showdown ankommen. Das Regime in Peking scheint gut gewappnet, doch mit der Schmerztoleranz der eigenen Bevölkerung ist es nicht mehr so weit her wie früher.
Die Mutter der französischen Schriftstellerin litt an Alzheimer. Nun ist Ernaux’ Tagebuch über die letzte gemeinsame Zeit mit ihr auf Deutsch erschienen.
Die neuesten Meldungen aus dem Feuilleton.
Plötzlich ist es Mode, über die Wechseljahre zu reden. Die Gynäkologin Susanne Spoerri sieht den Hype um Hormone kritisch, wozu neuerdings Testosteron gehört: Frauen setzten sich unter Druck, begehrenswert zu bleiben.
Deutschland hat eine neue Regierung. Und ähnliche Probleme wie Anfang der 1960er Jahre. Das Buch, das Ludwig Erhard über seine damalige Kanzlerzeit geschrieben hat, liest sich wie ein Déjà-vu.
Für die unmittelbare Zukunft hängt viel davon ab, wie und ob der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew sieht eine Zeit der Barbaren heraufziehen.
Trump kann noch so wüten: Der Antiamerikanismus bleibt bisher erstaunlich zahm. Das hat auch mit Europas Formschwäche zu tun.
Die Trump-Administration kürzt den Universitäten Hunderte Millionen Dollar. Das ist einschneidend, aber eine zum Teil berechtigte Reaktion auf woke Programme, die Antisemitismus gefördert haben.
Es geht um eine Kämpferin, die wegen einer chronischen Krankheit eher fürs Lazarett als fürs Schlachtfeld gemacht scheint. Ein Bucherfolg, der viel sagt über die Unterhaltungspräferenzen unserer Zeit.
Experten warnen vor dem dritten Weltkrieg, Wissenschafter vor dem Ende der Welt: Angst prägt das Lebensgefühl einer Wohlstandsgesellschaft, die ihr Verschontsein nicht mehr erträgt.
In der digitalen Gesellschaft muss alles in Echtzeit geschehen. Das verändert das subjektive Zeitgefühl. Aber auch die Zeitwahrnehmung der Menschen.
Der Personalmangel der reformierten Landeskirchen droht zur finalen inhaltlichen Aushöhlung ihrer Glaubensgrundlagen zu führen. Was wird davon noch übrigbleiben?
Millie Bobby Brown wehrt sich gegen Online-Kommentare, sie sehe mit Anfang 20 aus wie 40. Die Schauspielerin ist nicht die erste, die sich vorwerfen lassen muss, sie sehe älter aus, als sie ist.
Strafzölle von 100 Prozent will der US-Präsident auf Filme verhängen, die im Ausland gedreht wurden. Spielt «Mission: Impossible» bald nur noch in Nordamerika?
Ein Film über die Geschichten von Olympia-Sportlerinnen und -Sportlern, die nicht mehr für ihr Heimatland antreten können.
Eine Lebensgeschichte muss zusammengesetzt werden. Über weite Strecken funktioniert die biografische Spurensuche hervorragend.
Der Berner Filmemacher Piet Baumgartner lädt Bagger zum Ballett und macht aus den Herzen eine Baugrube.
Zwischen absoluter Selbstermächtigung und erniedrigender Fremdbestimmung: «Oxana» ist ein Meisterwerk über eine beeindruckende Künstlerin.
Er zählt zu den bedeutendsten Musikern der letzten fünfzig Jahre. Dank seiner stupenden Musikalität hat sich Keith Jarrett als Jazz-Improvisator ebenso profiliert wie als Klassik-Interpret. Seit einem Schlaganfall kann der Amerikaner nicht mehr auftreten.
Die Folgen von Brexit, Covid und Inflation lasten schwer auf der britischen Musikszene. Nun hoffen Künstler und Business, dass neue Verhandlungen mit der EU aus der Misere helfen.
Der französisch-libanesische Intendant und Regisseur hat die Opernwelt in Europa geprägt, dreissig Jahre lang als Opernchef in Amsterdam, zuletzt in Aix-en-Provence. In der Nacht zum 3. Mai ist Pierre Audi im Alter von 67 Jahren in Peking gestorben.
Wie verdichtet man die 800 Seiten eines Weltbestsellers zu einem Bühnenwerk? Bei der Vertonung von Ecos «Il nome della rosa» hat der Komponist Francesco Filidei diese Herausforderung raffiniert gemeistert. Die Uraufführung an der Scala lässt aufhorchen.
Hat der britische Pop-Star Inspirationen für sein Album «Outside» in einer österreichischen Nervenheilanstalt gefunden? Ein Bildband dokumentiert die Begegnung David Bowies mit den künstlerisch versierten Insassen Guggings.
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Der deutsche Historiker Norbert Frei sagt, wie die Transformation des Nazistaats gelang – und wie er die Gefahr eines neuen Faschismus einschätzt.
Das Deutsche Reich lag in Scherben, das Ende des Zweiten Weltkriegs war nur noch eine Frage der Zeit. Und Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, verhandelte in Österreich über eine Nachkriegsregierung.
Die Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs sind vorbei. Aber fertig wird man mit dem Thema nie: Wir stellen Bücher vor, die in den letzten 75 Jahren Debatten auslösten und Reflexionen anstiessen – oder unsere Sicht auf den Krieg bis heute prägen.
Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Offiziell. In einzelnen Teilen Deutschlands war er schon viel früher fertig. Und in Japan stand das Schlimmste noch bevor.
Vor achtzig Jahren trafen sich die «Grossen Drei» zu Verhandlungen über die Nachkriegsordnung. Was sie damals beschlossen, unterscheidet sich fundamental von der Legende über jene Konferenz, die tief in vielen Köpfen sitzt. Das hat politische Folgen bis heute.
Tausende von Menschen baten den Papst im Zweiten Weltkrieg, gegen das Unrecht der Nazis Stellung zu nehmen. Alle wurden mit der gleichen Antwort abgefertigt.
Joseph Spring wurde 1943 von Schweizer Grenzwächtern dem Nazi-Regime ausgeliefert und landete in Auschwitz – nun ist er kurz vor seinem 98. Geburtstag gestorben.
In diesen Tagen jährt sich das Ende der norditalienischen Partisanenrepublik Ossola zum 80. Mal. In Domodossola und im Onsernonetal sind die Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg immer noch sehr präsent.
Ein Krieg, wie er derzeit in der Ukraine stattfindet, gehört zu den extremsten menschlichen Grenzerfahrungen. Der polnische Romancier Szczepan Twardoch meistert die unmögliche Aufgabe, ihn in seiner Brutalität und Sinnlosigkeit zu beschreiben, mit Bravour.
Geschichte macht meistens an den Staatsgrenzen halt. Zu Unrecht, findet David Blackbourn. Für sein Buch «Die Deutschen in der Welt» hat der britische Historiker einen universalen Ansatz gewählt.
Mit seinem neuen Roman beweist Martin Suter erneut sein Talent für zügige Handlungen und menschliche Abgründe. Und schafft es auf Platz eins aller deutschsprachigen Bestsellerlisten. Warum so viele diese Bücher wollen.
Der Skeptiker hinterfragt, was die Masse für richtig hält. Die Figur hat eine lange Tradition, in der Gegenwart ist er in Verruf geraten.
Mit «See der Schöpfung» ist der Amerikanerin ein Überraschungserfolg gelungen. Im Interview ergründet sie, warum ihr Roman über Neandertaler und Ökoaktivisten einen Nerv getroffen hat.
Stephan Balkenhol ist ein deutscher Bildhauer von Weltrang. Seine Skulpturen laden die Betrachter ein, über sich selbst nachzudenken. Für die NZZ hat er nun eine eigene Kunstedition geschaffen.
Esther Mathis ist in den letzten Jahren aufgefallen mit poetischen Werken, in denen oft physikalische Erkenntnisse mitschwingen. Für die NZZ hat sie nun die Farbtöne von Gewitterstürmen in ebenso reduzierten wie reizvollen Objekten gebannt.
Für Katharina Grosse kann alles zum Bildträger werden. Sie bemalt nicht nur Leinwände, sondern auch Wände, ganze Räume und Fassaden. Neuerdings nützt sie auch gebogenes und gewalztes Aluminiumblech als «Unterlage» für ihre genauso überlegte wie spontane Malerei in starken Farben.
Auf einem grossen Tisch liegen Materialmuster und Zeichnungen, rundherum wimmelt es von riesigen Leinwänden in leuchtenden und vibrierenden Farben, die teilweise noch auf ihre Fertigstellung warten. Wer das Studio von Renée Levi und ihrem Partner Marcel Schmid besucht, taucht augenblicklich in ein sinnliches künstlerisches Universum ein.
Nicht nur für seine Sammlungen ist der Louvre in Paris weltberühmt. Auch mit hervorragenden Sonderausstellungen tritt er immer wieder in Erscheinung: jetzt mit einer Schau zum Kunstförderer Rudolf II. Allerdings ächzt das Weltmuseum unter Übertourismus.
Das Musée des Beaux-Arts in Rennes hat einen Neubau in einer Plattenbausiedlung errichten lassen. Kultur wird hier in den Dienst der städtischen Transformation gestellt.
«Caravaggio 2025» im Palazzo Barberini in Rom ist ein Publikumsmagnet. 24 Werke, darunter einige bisher selten gezeigte, lassen den Werdegang des rebellischen Malers nacherleben.
Anselm Kiefer fand als Erstes in den Niederlanden Anerkennung. Und sein Held war schon als Teenager Vincent van Gogh. Zu Kiefers 80. Geburtstag richtet Amsterdam dem deutschen Berserker der Nachkriegskunst eine Retrospektive gleich in zwei Museen aus.
Im Jahr 2024 konnten wieder deutlich mehr Besucher ins Kunsthaus gelockt werden. Dazu trug auch die Ausstellung mit dem internationalen Performance-Star Marina Abramovic bei. Dennoch hat das grösste Museum der Schweiz das Budget noch nicht im Griff.
Die neuen Intendanten Pinar Karabulut und Rafael Sanchez haben das Programm der Saison 2025/26 vorgestellt. Sie setzen auf ein neues Ensemble, vielfältige Handschriften und profilierte Regisseure.
Vor 100 Jahren wurde der deutsche Humorist in Moers geboren. Er fand das Komische und Tragikomische im Alltag und sorgte mit knappen Mitteln für grosse Pointen.
Im Zürcher Schiffbau wird Nietzsches Klassiker als multimediales Happening inszeniert. Mit Tanz und Kunst will der Philosoph die Menschen aus der existenziellen Leere hinausführen. Deshalb gibt es auch einen Rave für Darsteller und Publikum.
Das legendäre Magazin feiert seinen hundertsten Geburtstag. Die Gabe, aus einem noch so kleinen Thema grosse Reportagen zu machen, beschert dem Heft weltweit Fans.
In einer bemerkenswert forschen Inseratekampagne stellt sich die konservative britische Traditionszeitung hinter die Ukraine. Warum?
Der Milliardär Jeff Bezos mischt sich bei der «Washington Post» in redaktionelle Belange ein. Die Folgen sind bis anhin positiv.























