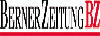
Mit «#lookoftheday» zeigt Bühnen Bern einen dokumentarischen Abend über die Modeindustrie. Was das Theater dabei bewirken kann.
Julius Schien fotografierte 90 Tatorte rechtsextremer Morde. Er sagt, wieso seine Bilder auch mal idyllisch wirken – und warum ihm in einem Waldstück die Tränen kamen.
Sie zählte einst zu den grössten Popstars, nun ist die Sängerin Zielscheibe von Spott und Häme. Wie kam es zur Imagekrise?
Jeden Tag erreicht die Berner Zeitung eine Vielzahl an Leserbildern. Eine Auswahl der schönsten Fotos finden Sie hier.
Mit dem kritischen Theaterstück «Eine besondere Strasse» riskiert die Georgierin Rusudani Tabukaschwili Repressalien. «Man muss die Dinge so benennen, wie sie sind», sagt die Autorin im Gespräch.
Das Victoria & Albert Museum rückt die legendäre Schmuck- und Uhrenmarke ins Rampenlicht. Unter anderem ist eine Uhr von Jackie Kennedy zu sehen – aber das kostbarste Stück ist ein anderes.
Die Behörden präsentieren einen überraschend hohen Schätzwert, wie viele Übergriffe sie während der ESC-Woche erwarten.
Michael Jackson sollte eigentlich auf dem Soloalbum von Queen-Sänger Freddie Mercury zu hören sein. Doch die Zusammenarbeit scheiterte an Jacksons Vorliebe für exotische Tiere.
Etwas verbergen, um etwas anderes zu enthüllen. Der international bekannte Künstler Ibrahim Mahama thematisiert in Bern die koloniale Prägung seines Heimatlandes Ghana durch die Schweiz.
Klassenkampf mit Laserkanonen: Die zweite Staffel von «Andor» verleiht der Weltraumsaga neue Tiefe.

Kann man Christ und zugleich Materialist sein? Ja, findet der slowenische Philosoph. Und vielleicht müsse man das sogar. Denn Religion sei die Grundlage jeder emanzipatorischen Politik.
Zwischen absoluter Selbstermächtigung und erniedrigender Fremdbestimmung: «Oxana» ist ein Meisterwerk über eine beeindruckende Künstlerin.
Wolfgang Benz erzählt die Geschichte der Emigration aus Nazideutschland, Taina Tervonen sucht Spuren der Verschwundenen in Bosnien und Herzegowina und Ilka Quindeau versucht, die Wurzeln des Antisemitismus zu erklären.
Um die innere Leere zu bekämpfen, braucht es Superkräfte: Im neuen Marvel-Film stehen sich statt Übermenschen eher Über-Ichs gegenüber.
Die Werke von Torborg Nedreaas (1906–1987) gehören in Norwegen zum Kanon des politisch-literarischen Feminismus zwischen Klassen- und Geschlechterkampf. Ihr Roman «Nichts wächst im Mondschein» kommt langsam in Gang, entwickelt dann aber einen mächtigen Sog.
Der Welt gehe es immer schlechter, das ist ein verbreiteter Glaube. Der Soziologe Heinz Bude widerspricht. Die Krisenstimmung könne bewirken, dass die ganze Gesellschaft wieder politischer werde.
Anselm Kiefer fand als Erstes in den Niederlanden Anerkennung. Und sein Held war schon als Teenager Vincent van Gogh. Zu Kiefers 80. Geburtstag richtet Amsterdam dem deutschen Berserker der Nachkriegskunst eine Retrospektive gleich in zwei Museen aus.
Hat der britische Pop-Star Inspirationen für sein Album «Outside» in einer österreichischen Nervenheilanstalt gefunden? Ein Bildband dokumentiert die Begegnung David Bowies mit den künstlerisch versierten Insassen Guggings.
Wie verdichtet man die 800 Seiten eines Weltbestsellers zu einem Bühnenwerk? Bei der Vertonung von Ecos «Il nome della rosa» hat der Komponist Francesco Filidei diese Herausforderung raffiniert gemeistert. Die Uraufführung an der Scala lässt aufhorchen.
Für die unmittelbare Zukunft hängt viel davon ab, wie und ob der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew sieht eine Zeit der Barbaren heraufziehen.
Im Jahr 2024 konnten wieder deutlich mehr Besucher ins Kunsthaus gelockt werden. Dazu trug auch die Ausstellung mit dem internationalen Performance-Star Marina Abramovic bei. Dennoch hat das grösste Museum der Schweiz das Budget noch nicht im Griff.
Trump kann noch so wüten: Der Antiamerikanismus bleibt bisher erstaunlich zahm. Das hat auch mit Europas Formschwäche zu tun.
Die Trump-Administration kürzt den Universitäten Hunderte Millionen Dollar. Das ist einschneidend, aber eine zum Teil berechtigte Reaktion auf woke Programme, die Antisemitismus gefördert haben.
Es geht um eine Kämpferin, die wegen einer chronischen Krankheit eher fürs Lazarett als fürs Schlachtfeld gemacht scheint. Ein Bucherfolg, der viel sagt über die Unterhaltungspräferenzen unserer Zeit.
Experten warnen vor dem dritten Weltkrieg, Wissenschafter vor dem Ende der Welt: Angst prägt das Lebensgefühl einer Wohlstandsgesellschaft, die ihr Verschontsein nicht mehr erträgt.
In der digitalen Gesellschaft muss alles in Echtzeit geschehen. Das verändert das subjektive Zeitgefühl. Aber auch die Zeitwahrnehmung der Menschen.
Der Personalmangel der reformierten Landeskirchen droht zur finalen inhaltlichen Aushöhlung ihrer Glaubensgrundlagen zu führen. Was wird davon noch übrigbleiben?
Millie Bobby Brown wehrt sich gegen Online-Kommentare, sie sehe mit Anfang 20 aus wie 40. Die Schauspielerin ist nicht die erste, die sich vorwerfen lassen muss, sie sehe älter aus, als sie ist.
Sie wurde an ihrer Universität gemobbt, weil sie auf dem biologischen Geschlecht beharrte. Schliesslich kündigte Kathleen Stock ihre Stelle. Nun aber profitiert die britische Feministin von einer neuen Behörde, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt.
Ein Börsenmann wird zum Robin Hood in eigener Sache: Fast zwanzig Jahre nach seinem Welterfolg agiert Jon Hamm erneut auf der Höhe seines schauspielerischen Könnens.
Ein internationales Schachturnier in den Alpen wird von Todesfällen überschattet. «Zugzwang» heisst der starke Fall, bei dem längst nicht alles schwarz-weiss ist.
Ein neues Genre ist geboren. Nennen wir es Blood’n’Blues.
Mit «Shoplifters» gewann Hirokazu Koreeda vor ein paar Jahren die Goldene Palme in Cannes. Nun seziert er auch in einer Netflix-Serie meisterlich eine Familiendynamik.
Falls er Angst habe, ersetzt zu werden, könne er auch mit einer Öllampe losziehen, spottet die Einsatzleiterin. Der Fall ist aber nicht zum Lachen.
Jordi Savall dirigiert in der Tonhalle Zürich zwei Bühnenwerke von Gluck und von Rameau, einmal mit szenischer Darstellung, einmal ohne. Die Wirkung der Musik verändert dies stark. Liegt im Audiovisuellen die Zukunft des Konzerts?
Seit sie sich mit Thomas Gottschalk bei «Wetten, dass . . .?» angelegt hat, ist sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seit ihrem siebten Nummer-eins-Hit, «Bauch, Beine, Po», ist Shirin David die erfolgreichste Sängerin Deutschlands. Doch die Konzerthalle bleibt bei ihrem Besuch in Zürich halb leer.
Der Hamburger Produzent DJ Koze hat den Discos schon unzählige ekstatische Momente beschert mit seinen Tracks. Auf seinem neuen Album setzt er auf klangliche Vielfalt.
Der gefeierte Pianist widmet sich einer wenig bekannten Seite Franz Liszts. Im Zentrum steht «Via crucis», ein ebenso karges wie intensives Gebet in Tönen. Für Leif Ove Andsnes hat dieses Spätwerk viel mit seinem eigenen Werdegang als Künstler zu tun.
Erich Wolfgang Korngolds «Die tote Stadt» ist ein Opernkrimi, aber auch eine subtile Warnung vor zu viel Lust an der Vergangenheit. Leider begnügt sich Dmitri Tcherniakov bei seiner Neuinszenierung am Opernhaus nicht mit dem komplexen Geschehen.
Das Deutsche Reich lag in Scherben, das Ende des Zweiten Weltkriegs war nur noch eine Frage der Zeit. Und Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, verhandelte in Österreich über eine Nachkriegsregierung.
Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Offiziell. In einzelnen Teilen Deutschlands war er schon viel früher fertig. Und in Japan stand das Schlimmste noch bevor.
Vor achtzig Jahren trafen sich die «Grossen Drei» zu Verhandlungen über die Nachkriegsordnung. Was sie damals beschlossen, unterscheidet sich fundamental von der Legende über jene Konferenz, die tief in vielen Köpfen sitzt. Das hat politische Folgen bis heute.
Tausende von Menschen baten den Papst im Zweiten Weltkrieg, gegen das Unrecht der Nazis Stellung zu nehmen. Alle wurden mit der gleichen Antwort abgefertigt.
Joseph Spring wurde 1943 von Schweizer Grenzwächtern dem Nazi-Regime ausgeliefert und landete in Auschwitz – nun ist er kurz vor seinem 98. Geburtstag gestorben.
In diesen Tagen jährt sich das Ende der norditalienischen Partisanenrepublik Ossola zum 80. Mal. In Domodossola und im Onsernonetal sind die Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg immer noch sehr präsent.
Frühling 1945: Der Krieg war für das Deutsche Reich verloren, Hitlers Getreue begannen sich abzusetzen. Die Verlautbarungen des «Führers» schwankten zwischen Fanatismus und Resignation.
Die Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs sind vorbei. Aber fertig wird man mit dem Thema nie: Wir stellen Bücher vor, die in den letzten 75 Jahren Debatten auslösten und Reflexionen anstiessen – oder unsere Sicht auf den Krieg bis heute prägen.
Thomas Mann, Ernst Toller und Sigmund Freud mussten fliehen, als die Nazis die Macht übernahmen. Zusammen mit Hunderttausenden von Juden und Regimegegnern. Wolfgang Benz will ein Gesamtbild der Emigration aus Hitlerdeutschland geben.
Der englische Autor ist einer der brillantesten Gegenwartsseismographen. «Nach dem Krieg» heisst sein neuer Erzählband, der in zwölf Varianten das gleiche, grosse Trauma verarbeitet: den Alltag nach dem Kampf.
Leon de Winters «Stadt der Hunde» ist ein überambitionierter Text, der viel zu viel will und für seine Erzählsprünge kein passendes Mass findet.
Die Journalistin Taina Tervonen hat ein Buch geschrieben über die weitreichende Folgen des Kriegs und die Heilsamkeit der Aufarbeitung.
Der norwegische Starautor Tomas Espedal pflegt «in einer ersten Person zu schreiben, die sich zu einer dritten Person erweitert». Nun hat er in dieser Art seinen Lebensroman verfasst: das mitreissende Buch seiner Erweckung zum kompromisslosen Künstler.
Stephan Balkenhol ist ein deutscher Bildhauer von Weltrang. Seine Skulpturen laden die Betrachter ein, über sich selbst nachzudenken. Für die NZZ hat er nun eine eigene Kunstedition geschaffen.
Esther Mathis ist in den letzten Jahren aufgefallen mit poetischen Werken, in denen oft physikalische Erkenntnisse mitschwingen. Für die NZZ hat sie nun die Farbtöne von Gewitterstürmen in ebenso reduzierten wie reizvollen Objekten gebannt.
Für Katharina Grosse kann alles zum Bildträger werden. Sie bemalt nicht nur Leinwände, sondern auch Wände, ganze Räume und Fassaden. Neuerdings nützt sie auch gebogenes und gewalztes Aluminiumblech als «Unterlage» für ihre genauso überlegte wie spontane Malerei in starken Farben.
Auf einem grossen Tisch liegen Materialmuster und Zeichnungen, rundherum wimmelt es von riesigen Leinwänden in leuchtenden und vibrierenden Farben, die teilweise noch auf ihre Fertigstellung warten. Wer das Studio von Renée Levi und ihrem Partner Marcel Schmid besucht, taucht augenblicklich in ein sinnliches künstlerisches Universum ein.
Vor weniger als 200 Jahren versuchte man mit klugen Erweiterungsplänen das unerhörte Wachstum der europäischen Metropolen in den Griff zu bekommen. Diese Kultur brach Mitte des 20. Jahrhunderts ab – paradoxerweise genau dann, als die Herausforderungen an die Städte noch grösser wurden.
Zur 750-Jahr-Feier der niederländischen Hauptstadt zeigt die amerikanische «Leiden Collection» des Unternehmers Thomas Kaplan nicht weniger als 18 Gemälde von Rembrandt sowie weitere Meisterwerke aus dessen Umkreis – und einen raren Vermeer.
In Manhattan hat die Firma JP Morgan Chase von Norman Foster, dem Hightech-Star unter den Architekten, einen neuen Bankenturm errichten lassen. Der Betrieb des Turms ist vollelektrisch.
Er zeichnete nur für sich selbst. Seine Ideen auf Papier sind in Stunden fast unbewusster Träumerei entstanden. Nun sind Victor Hugos verblüffende Zeichnungen in einer Londoner Ausstellung zu sehen.
Wolfgang Tillmans ist einer der renommiertesten Künstler unserer Zeit. Er zeigt schreiend bunte Stillleben und Küsse – zärtlich und leidenschaftlich. Das Dresdner Albertinum widmet ihm eine grosse Ausstellung.
Sebastian Hartmann hat sich einst als Theater-Rebell in Stellung gebracht. Unterdessen zählt er zu den profiliertesten deutschsprachigen Regisseuren. Im Schiffbau inszeniert er «Also sprach Zarathustra» von Friedrich Nietzsche.
«Elisabeth!» von Mareike Fallwickl ist ein feministisches Lehrstück. Dank der Schauspielerin Stefanie Reinsperger zeigt sich die Protagonistin als lebendige Frau mit Ecken und Kanten.
Die Berliner Philharmoniker verabschieden sich nach dreizehn Jahren mit Puccinis «Madama Butterfly» von ihrer österlichen Residenz im Festspielhaus Baden-Baden und spielen künftig wieder in Salzburg. Die Rochade ist eine Chance für beide Festspielstädte.
Der Milliardär Jeff Bezos mischt sich bei der «Washington Post» in redaktionelle Belange ein. Die Folgen sind bis anhin positiv.
Amerikanische Organisationen haben eine neue Methode der russischen Einflussnahme offengelegt. Deutsche Medien berichten darüber mit einem alarmistischen Unterton. Damit bedienen sie die Interessen des Kremls.
Darf man ukrainische Kinder und russische Soldaten auf eine Stufe stellen? Zwei Auszeichnungen sorgen für Empörung.























