
Am Donnerstagabend wurde in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern der Schweizer Grand Prix Literatur vergeben. Pascale Kramer aus der Romandie erhielt die Auszeichnung für ihr Gesamtwerk.
Nicht nur Donald Trump kann sich verkaufen. Auch die Frauen um den Präsidenten wissen aus ihrem Auftritt auf der nationalen Bühne Kapital zu schlagen.
Menschen in Existenznot bevölkern die Werke der Schriftstellerin Pascale Kramer. Mit poetischer Genauigkeit zeichnet sie prekäre Daseinsverhältnisse. Nun erhält sie für ihr Werk den Schweizer Grand Prix Literatur.
Ohne Charles Linsmayer gäbe es einen grossen Teil der Schweizer Literatur nicht mehr. Seit vielen Jahren holt er Vergessenes und Verschollenes zurück ins Bewusstsein.
365 Titel wurden eingereicht, 15 haben es auf die Shortlist des Leipziger Buchpreises geschafft. Darunter «Hagard »von Lukas Bärfuss – ein Buch, das noch gar nicht erschienen ist.
Rüdiger Safranski erhält den Ludwig-Börne-Preis 2017. Der deutsche Schriftsteller und Essayist wird für seine luziden Analysen zur deutschen Geistesgeschichte geehrt.
Er war ein Querdenker, an dessen Kanten sich manche rieben. Vor allem aber war Al Imfeld ein vielseitig informierter und interessierter Mittler zwischen der deutschsprachigen Welt und Afrika.
Sieben Monate nach Schliessung des Essl-Museums in Österreich ist die Zukunft einer der weltweit grössten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst gesichert.
Was ist eigentlich gute Kunst? Wer nach den Beurteilungskriterien fragt, kann bei Kunst-Juroren auf verwunderliche Praktiken stossen. Dem Kunsturteil haftet oft Willkür und Intransparenz an.
Der Internetkonzern Google ist allwissend und allmächtig. Seine Satelliten beobachten uns, seine Algorithmen können unsere Präferenzen kreieren, selbst am Tod wird schon geforscht: Geriert sich Google als Gott?
Die Schweiz, ein standhaftes Fragezeichen? Oder: Was geschieht, wenn sich fünf Fotografen ein Bild eines Landes machen, das nicht nur ihnen ein Rätsel ist?
Er ist Filmstar, Weinbauer, Immobilienhändler, Gastwirt – und jetzt singt Gérard Depardieu auch noch. Lieder von Barbara, der französischen Chanson-Legende. Die Texte hat er dafür aber nicht auswendig gelernt.
Lange galt Sayed Kashua als «Vorzeige-Araber» in Israel. Aber faktisch entfremdete er sich seinen Landsleuten, ohne bei den jüdischen Israeli anzukommen. Seine Texte leuchten dieses Zwischenreich aus.
Die Linke verliert mehr und mehr Wähler an rechtsnationale Parteien. Wie lässt sich dieser Trend umkehren?
Die Amerikanerin Lydia Davis ist nicht nur eine herausragende Schriftstellerin, sondern auch eine passionierte Übersetzerin. Diese Arbeit empfindet sie als massgebliche Bereicherung ihres Schreibens.
Die Übertragung von Lyrik ist in sich schon eine eminente Herausforderung. Was tun Übersetzer, wenn zudem kulturelle Distanzen überwunden oder extrem unterschiedliche Register bedient werden müssen?
Mit gutem Grund mokierte man sich über das Kauderwelsch der ersten computergenerierten Übersetzungen. Aber seit neuronale Netze eingesetzt werden, hat die Technologie einen Sprung nach vorn gemacht.
Die liberale Welt ist ein zerbrechliches Gebilde. Ihre Schönheit zeigt sich gerade in unsicheren Zeiten. Wer hat den Mut, für sie einzustehen?
Jüngst hat «Der Spiegel» gegen die universitäre Germanistik polemisiert. Sie sei ohne Ausstrahlung und ohne Relevanz. Ganz im Gegenteil, findet die Zürcher Professorin Frauke Berndt in ihrer Antwort auf die Polemik.
Borussia Dortmund empfing jüngst den RB Leipzig, und der Hass brach sich Bahn. Solche Enthemmungen sind nur der Menschenmenge möglich. Aber der Mob randaliert auch anderswo, immer häufiger.
Bertrand Grébaut führt die zurzeit angesagteste Sterneküche von Paris. Dass man bei ihm an einfachen Holztischen isst und die Kellner Turnschuhe tragen, erhöht den Genuss.
Israels Orthodoxe ziehen viel Unmut auf sich. Aber auch Strenggläubige suchen Wege in die Zeitgenossenschaft – so etwa die jungen Filmemacherinnen.
Nur um Kricket dreht sich Aravind Adigas jüngster Roman. Nur? Im Kricket, so findet der Schriftsteller, bilden sich politische, wirtschaftliche und persönliche Aspekte ab, die Indien heute prägen.
Marokko will den religiösen Extremismus im Keim ersticken – und legt dafür eine Parforceleistung hin.
Anderthalb Schritte vor, einen zurück – so kämpfen Irans reformorientierte Kulturbeauftragte um Freiräume für die Kunst. Auch im Bildungsbereich strebt man kleine Entschärfungen der Doktrin an.
Mit Empathie erzählt ein neues Buch vom Hoffen und Scheitern der «Bauhaus-Stossbrigade Rot Front» im Moskau Stalins. Es kann aber die ausstehende architekturhistorische Forschung nicht ersetzen.
Durch den jahrelangen Erbstreit fast zwei Jahre später als geplant werden nun kommenden November zeitgleich zwei inhaltlich unterschiedliche Präsentationen realisiert.
Seine Ansichten lösen sich zusehends auf in lichte Farbfelder, als ob ein dunstiges Licht alles überstrahlte. Calderaras Malerei gilt dem Nichts, das die ganze Welt in sich birgt.
Unbeschönigte Vergänglichkeit in einem Garten von Fischli/Weiss: Von unkontrollierbarer Witterung und empörten Schafen.
Grünfassade trifft auf Naziarchitektur: Wie soll das Haus der Kunst in München saniert werden?
Der für einen Oscar nominierte Animationsfilm des Westschweizer Regisseurs Claude Barras ist ein wahres Juwel. Zwischen Tragik und Humor changierend, findet er einzigartige Wege des Ausdrucks.
Wim Wenders hat Peter Handkes Bühnendialog «Les beaux jours d'Aranjuez» verfilmt. Er zeigt das Leben und die Liebe im Augenblick der Unschuld, voller Pathos und erbarmungslos nah am Kitsch.
Danny Boyle versammelt seine Antihelden aus dem Kultfilm von 1996 zu einem der besten Sequels der vergangenen Jahre. Hinter dem Vorhang des Rausches erscheinen nun deutlicher die Umrisse von Menschen.
Garth Davis' Film erzählt die wahre Geschichte eines in der Fremde aufgewachsenen Inders, der seine Wurzeln sucht, mit viel Zugewandtheit. Doch kippt der Film mitunter in epische Sentimentalität.
Wann entwickeln Filme politische Kraft? Ein Film über den Syrien-Krieg («Insyriated») und der einzige türkische Festivalbeitrag «Kaygi» gehen unterschiedlich gelungene Wege.
Das Ermittlerteam Brasch und Köhler muss einen Entführungsfall lösen. Doch Schwindeleien und das eigene Urteilsvermögen machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Serien wie «Mr. Robot» zeigen, worin das neue, interaktive Fernseherlebnis besteht: Das Medium der Vereinzelung wandelt sich zum Medium der Verständigung.
Die Schauspielerin wird nur noch zweimal als Kommissarin Sarah Brandt zu sehen sein. Das NDR bedauert diesen Schritt.
Dorn und Lessing gehen in «Der scheidende Schupo» dem Mordanschlag auf einen Kollegen mit ironischer Halbdistanz nach. Da gibt es einiges zu lachen.
Die erste Staffel von «Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events» ist der Anfang vom Ende mit Schrecken: Morbide, schrill, selbstreferenziell.
Mit dem TV-Zweiteiler «Landgericht» nach Ursula Krechels gleichnamigem Roman rückt die verdrängte deutsch-jüdische Nachkriegsgeschichte in den Blick.
Der argentinische Pianist Nelson Goerner und das Orchestre de la Suisse Romande unter der Leitung von Jonathan Nott erweisen sich im Konzert in der Zürcher Tonhalle als optimale Partner.
Der grandiose Jazzsänger Al Jarreau ist 76-jährig in Los Angeles gestorben. Er zauberte mit seinem Mundwerkzeug die tollsten Klänge und Töne hervor.
Die beiden Pianistinnen Katia und Marielle Labèque wurden bei ihrem Konzert in der Zürcher Tonhalle von der Slam-Poetin Hazel Brugger begleitet. Der Abend gab viel zu lachen und zu staunen.
Der Sänger Sampha zelebriert die neue Empfindsamkeit im Pop. Ausserdem beweist er sich auf seinem Debütalbum auch als geschickter Produzent.
Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Nicolai Gedda, einer der grossen Tenöre des 20. Jahrhunderts, am 8. Januar 2017 im Alter von 91 Jahren in Tolochenaz bei Lausanne gestorben.
Als Fan und Promotorin ihrer Pippi-Bücher wurde die Berlinerin Louise Hartung nach 1953 zu einer engen Freundin Astrid Lindgrens. Diese wies ihre erotischen Avancen aber entschieden ab.
Mit Empathie erzählt ein neues Buch vom Hoffen und Scheitern der «Bauhaus-Stossbrigade Rot Front» im Moskau Stalins. Es kann aber die ausstehende architekturhistorische Forschung nicht ersetzen.
Der nicaraguanische Dichter fühlt sich politisch verfolgt. Er überlegt deshalb, sein Heimatland zu verlassen.
Der Versuch der Deutschen Nationalbibliothek, ihre Nutzer zur Ausleihe digitaler Ausgaben zu drängen, ist gescheitert. Statt Zwang soll nun Aufklärung helfen.
Achim Landwehrs «Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit» ist ein anregender, aber auch etwas ermüdender Essay zur Geschichtstheorie.
Männermordender Vamp? Unschuldsmädel mit Schmollmund? Mit Barbara Hannigan in der Titelrolle erlebt man Alban Bergs «Lulu» an der Hamburgischen Staatsoper völlig neu – besonders den problematischen Schluss des Stücks.
Er geht, und er tut es so, wie man es von ihm erwarten konnte. Claus Peymann verabschiedet sich nach siebzehneinhalb Jahren vom Berliner Ensemble. Wird Berlin ihn vermissen?
Das Ballett Zürich tanzt Stücke aus drei Generationen. Christian Spucks Tänzerinnen und Tänzer erweisen sich als ein Trupp äusserst quirliger Geister.
Milo Rau zeigt im Zürcher Schiffbau das Stück «Die 120 Tage von Sodom» nach Motiven von Pasolini und Sade. Es ist eine Grenzerfahrung, die so nicht zu erwarten war.
Aus dem Schatten der Callas zu treten: Dazu bedurfte es wahrhaft sängerischer Überzeugungskraft. Leontyne Price, die am 10. Februar ihren 90. Geburtstag feiern konnte, verfügte darüber fast im Übermass.
Welches ist das Verhältnis grosser Gegenwartskünstler zu ihren Assistentinnen, Zu-Dienern, ihren im wahrsten Sinne des Wortes Mit-Arbeitern? Immer wieder hört man von Unstimmigkeiten und Streitfällen.
Dass Kunst als eine Art Ersatzreligion fungiert, wird immer wieder behauptet. Der Glaube ist aber nicht wirklich zurückgekehrt. Kunst wird heute vielmehr als Religionsersatz gefeiert, und dies ganz bewusst und gerade auf den jeweils rituell begangenen Messen.
Ein intimer Salon möchte man sein, keine Messe mit ihrem merkantilen und marktschreierischen Jahrmarktcharakter. Die Art Genève bietet einen eklektischen Mix aus Alt und Neu auf hohem Niveau, der ein vor allem regionales Publikum offensichtlich anspricht.
Die Reliquien der Vergangenheit werden immer wertvoller. In Zeiten der Restauration setzen Eliten auf Altbewährtes. Sie schwärmen für Monets und Renoirs. Das Geschäft mit dem Impressionismus boomt.
Was zählt, ist das herausragende Einzelstück. Viele Aussteller an der Brafa bringen höchste Qualität und können damit auch den alten Fuchs unter den Sammlern animieren.
Die Credit Suisse schränkte an ihrer Jahreskonferenz die Bewegungsfreiheit der Fotografen ein. Sie störten den Anlass hiess, es. Das klingt verdächtig.
Die digitalen Techniken regen dazu an, die Mediennutzer als beliebig manipulierbare Personen wahrzunehmen. Für entsprechende Thesen gibt es bisher kaum Belege.
Die Schweizer werden mit einer Informationskampagne aufs Digitalradio eingestimmt. Offen ist, welche Technik mehr Chancen haben wird: DAB+ oder das Internetradio.
Die Mehrheit der Schweizer Grossfirmen stellt immer noch Mitarbeiterzeitungen her. Gedrucktes steht dennoch unter Druck.
Die deutsche Ausgabe von "Charlie Hebdo" solidarisiert sich mit dem "Spiegel". Dazu variiert sie die umstrittene Trump-Karikatur des deutschen Magazins.
Wie steht es wirklich um die kontrovers beurteilte Akustik in der Hamburger Elbphilharmonie? Die ersten Konzerte des laufenden Eröffnungsfestivals ermöglichen aufschlussreiche Beobachtungen.
Die Hamburger Elbphilharmonie ist eröffnet, und die stolze Hansestadt feiert sich ungeachtet aller Widrigkeiten und Krisen rund um den Bau selbst – zu Recht.
Bei Jörg Widmanns Oratorium «Arche» musste sich die nach der Eröffnung kontrovers beurteilte Akustik der Elbphilharmonie erstmals in einer raumgreifenden Uraufführung bewähren.
Die Elbphilharmonie war in den vergangenen 16 Jahren abwechselnd ein Symbol des Aufbruchs und finsterstes Menetekel. Am Ende aber ist das himmelstürmende Gebäude viel mehr geworden als ein Konzertsaal.
Der weltweit ausstrahlende Erfolg der Hamburger Elbphilharmonie lässt vielerorts Überlegungen zu vergleichbaren kulturellen Leuchtturm-Projekten laut werden. Auch in Zürich könnte man sich dazu durchaus Gedanken machen.
Die Basler Architekten Herzog & de Meuron hörten am Montag, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung, zum ersten Mal das Herz ihrer Elbphilharmonie schlagen. Bericht von einem exklusiven Abend.
Mit dem Umbau und der phänomenalen Aufstockung eines alten Kaispeichers im Hamburger Hafen ist den Basler Architekten Herzog & de Meuron ein Meisterwerk gelungen. Eine Betrachtung.
Hamburg verdankt die Elbphilharmonie zwei Privatleuten – und einer Reihe von Zufällen
Bedeutende Denker, Forscherinnen und Wissenschafter präsentieren zwölf Begriffe, die jeder kennen sollte. Erlaubt ist, was fruchtbare neue Hypothesen hervorbringt.
Wenn wir Realität «sehen», merken wir gar nicht, wie viel wir selbst zu den scheinbar objektiven Eindrücken beisteuern. Beim Blick auf die physische Welt ist das dienlich – beim Urteilen ein Risiko.
Manchmal scheint es, als seien dem Erkenntnisvermögen des Menschen keine Grenzen gesetzt. Aber die Mysterianer mahnen zu Bedacht – und gründen ihre Argumente auf die Evidenz der Evolution.
Ob in der Physik, auf der Strasse oder im Ballett – immer geht es um Körper und ihre Bewegung im Raum. Fast könnte man von einem kleinsten gemeinsamen Nenner des Weltverständnisses reden.
Kein Laie wüsste zu sagen, worum es bei den von Claude-Louis Navier und George Stokes entwickelten Gleichungen geht. Aber die Liste der Bereiche, in denen sie zur Anwendung kommen, ist imposant.
Nie war so viel Information verfügbar wie im Internet-Zeitalter. Aber das heisst nicht unbedingt, dass unser Horizont damit erweitert wird.
Wissen halten wir in der Regel für ein begehrenswertes Gut. Aber es gibt Situationen, in denen Menschen freiwillig auf Information verzichten – und solche, in denen Unwissen sogar zweckdienlich ist.
Der zweite Hauptsatz ist für die Naturwissenschaft, was Shakespeare für die Literatur ist. Und wie Shakespeares Dramen zeigt er, dass Chaos die Natur der Dinge und Ordnung ein hart erkämpftes Gut ist.
Noch streitet die Fachwelt, ob das Weltzeitalter des Anthropozäns eingeläutet werden soll. Aber es bestehen kaum mehr Zweifel, wie entscheidend unsere Spezies die Erde und das Leben darauf verändert.
Den Code zu entschlüsseln, der das Funktionieren unseres Gehirns regiert – das ist einer der ambitioniertesten Träume der Wissenschaft. Der Erkenntnisgewinn wäre formidabel – und nicht ohne Risiken.
Manche Theorien gehen davon aus, dass Wahrnehmung nach dem Prinzip eines «Films im Kopf» funktioniert. Aber es könnte sein, dass unsere Sinne die Umwelteindrücke auf ganz andere Weise erfassen.
Die Idee der effektiven Theorie zeigt schön das Fortschreiten der Wissenschaft. Auch scheinbar fundamentale Einsichten können im Lauf der Zeit vertieft, erweitert und angereichert werden.
Wenn jemand den gesunden Menschenverstand hochhält, so denken wir, dann die Wissenschafter. Aber auch sie lassen sich offenbar immer wieder einmal zu Trugschlüssen verführen.
Sand, denken wir, ist das am wenigsten rare aller Güter. Weit gefehlt. Auf den Kapverden bietet das Sammeln des begehrten Baumaterials insbesondere Frauen ein Auskommen – aber es ist strafbar.
Frauen, die sich ihre Rechte nicht erstritten haben, sondern sie traditionsgemäss geniessen – das fasziniert die Fotografin Karolin Klüppel. Beim chinesischen Volk der Mosuo ist sie fündig geworden.
Wem käme es schon in den Sinn, in Affoltern auf Sightseeing-Tour zu gehen? Der NZZ-Fotograf Simon Tanner liess sich auf das Experiment ein - mit überraschendem Resultat.
Vor hundert Jahren hätte niemand gedacht, dass dereinst sogar ambitionierte Hobby-Alpinisten sich an den Mount Everest wagen würden. Was bedeutet der wachsende Zulauf für Menschen und Natur im Umland?
Was geschieht, wenn fünf internationale Fotografen sich ein Bild von der Schweiz machen? Was für ein Bild machen sie sich von dem Land, das sich manchmal selber nicht versteht? Die Fotostiftung Schweiz hat den Versuch gewagt. Unter dem Titel «Fremdvertraut» sind in Winterthur bis zum 7. Mai Arbeiten zu sehen, die auf Streifzügen durch die Schweiz entstanden sind.
Vor wenigen Tagen wurde US-Sänger Al Jarreau wegen Erschöpfung in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht. Nun ist der vielseitige Stimmkünstler am Sonntag im Alter von 76 Jahren in Los Angeles gestorben.
Während man in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik versucht, mögliche Entwicklungen anhand von Statistiken und Prognosetechniken vorherzusagen, boomt im Bereich des Films das Science-Fiction-Genre. «Things to Come - Science · Fiction · Film». Ausstellung vom 30. Juni 2016 bis 23. April 2017 in der Deutschen Kinemathek in Berlin.
Mit den 67. Filmfestspielen ist Berlin wieder im Berlinale-Fieber.
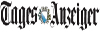
Die Ära der nackten Frauen sei definitiv vorbei, dachte man. Nun plant der «Playboy» ein Comeback, das keines wird.
Krystian Zimerman spielt, nein: erlebt Chopins Ballade Nr. 1.
Die renommierte Auszeichnung ist mit 45'000 Euro dotiert und wird am 23. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse vergeben.
Tamy Glauser ist als androgyner Typ gefragt – auch in der Trump-Ära?
Künstliche Intelligenz bedeutet nicht das Ende der Arbeit, denn seit Jahrtausenden gilt: Es gibt immer etwas Gescheites zu tun.
Als Fernsehformat hält sich die Gutenachtgeschichte erfolgreich. Die BBC lud am Valentinstag sogar Tom Hardy als Geschichtenonkel ein.
Adolf Muschg blickt in «Der weisse Freitag» auf die zweite Schweizreise des Dichters – und fragt sich, inwiefern das Leben gelingen kann.
Die Radio-Spartenprogramme von SRF wie Swiss Pop oder Swiss Jazz sollen eingestellt werden. Ein Pro und Contra.
Bei der Westminster Kennel Dog Show gibt es seltene Hunde zu sehen und mehr Pailletten als bei einem Mariah-Carey-Konzert. Am Ende offenbart sich die Ähnlichkeit von Mensch und Tier.
Stimmen Sie jetzt über die Schaadzeile ab. Der beste Vorschlag wird prämiert.
Das Vitra Design Museum erklärt, wie Roboter unser Leben verändern – eine grandiose Schau zwischen Untergang und Fortschritt.
Der türkische Schriftsteller und Nobelpreisträger kritisierte gegenüber der Zeitung das geplante Präsidialsystem. «Hürriyet» liess das Interview danach fallen.
Raoul Peck komponiert im Oscar-nominierten Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro» aus Aussagen des Schriftstellers James Baldwin eine kämpferische Collage über Schwarze in den USA.
«Wie erreicht man Donald Trump?», fragt John Oliver in der ersten Sendung nach der Pause. Seine Antwort: Werbespots im Fernsehen.























