
(Julie Hunt, swissinfo.ch/SRF 10vor10)
PLACEHOLDER Wie kann eine Stadt gegen wachsende Pendlerströme, Zubetonierung und verschandelte Landschaften kämpfen? Das von der restlichen Schweiz wenig beachtete Aarau erhält als "Vorbild für die innere Verdichtung" und dafür, dass die Identität der Wohnquartiere trotz Neubauten erhalten blieb, den Wakker-Preis 2014 des Schweizer Heimatschutzes. Schnauze um Schnauze an einem Auspuff stehen die Autos auf der Einfallstrasse ins Stadtzentrum. Es ist früh am Morgen, die Pendler fahren zur Arbeit. Am Bahnhof steigen Passagiere aus und ein. Dahinter drehen sich die Baukräne. Aarau baut und wächst, die Wirtschaft boomt. Aarau ist das Zentrum einer Agglomeration mit 80'000 Einwohnern, liegt im Dreieck Zürich, Basel, Bern, hat 20'000 Einwohner und 30'000 Arbeitsplätze. Das sei "eine landesweite Besonderheit und ein Missverhältnis", sagt Stadtbaumeister Felix Fuchs. "Deshalb sind wir seit Jahren bestrebt, zusätzlichen Wohnraum zu bauen." Mehr Wohnungen in der Stadt, das heisst weniger Pendlerverkehr in die Stadt, aber auch zusätzlicher Bedarf an Boden. Statt wie vielerorts in der Schweiz üblich Landwirtschaftsland, Naherholungsgebiete und andere Grünflächen in Bauland zu verwandeln, setzt Aarau seit rund 20 Jahren konsequent auf eine Begrenzung der besiedelten Gebiete, auf Verdichtung, die Erneuerung und Aufwertung bestehender Quartiere und auf die Umnutzung ehemaliger Gewerbe- und Industrieareale. Kompakte, verdichtete Siedlungsräume sind ein Gebot der Stunde in einer Schweiz, die zusehends zubetoniert, mit einem Siedlungsbrei überzogen wird und unter Platznot und wachsenden Pendlerströmen leidet. Die Stadt setzt seit Jahren die Rahmenbedingungen des revidierten schweizerischen Raumplanungsgesetzes um, das die Stimmbürger 2013 mit grossem Mehr gutgeheissen haben und das seit dem 1. Mai 2014 in Kraft ist. Dass Aarau bereits in einer Zeit, als der Boden im Land noch nicht so rar war wie heute, auf eine hohe Ausnützung gesetzt hat, zeigt die Hochhaussiedlung "Telli". Sie wurde zwischen 1970 und 1989 und schon damals verkehrsfrei gebaut. PLACEHOLDER Felix Fuchs ist seit 25 Jahren Stadtbaumeister und hat die Stadtentwicklung und die Transformation wesentlich mitgeprägt. 63-jährig, kommt er "langsam ans Ende der Amtsperiode", aber "jetzt werden noch wesentliche Eckpunkte der planerischen Bemühungen sichtbar", sagt er mit Blick auf Gebäude, die zurzeit im Bau sind oder kürzlich die Baubewilligung erhalten haben. Ein zentral gelegenes, grosses Entwicklungsgebiet der Stadt ist das Torfeld Süd, eine grosse Industriebrache neben dem Bahnhof. Bis im Frühjahr 2013 stand am Eingang des Areals hier ein 12-stöckiges Hochhaus. Es wurde als erstes Hochhaus der Schweiz gesprengt: Die Besitzerin kam zum Schluss, dass ein Neubau günstiger kommt als eine Sanierung. Ins Zentrum mit dem Fussball-Stadion Jetzt, ein gutes Jahr später, stehen hier Baukräne. Ein neues Hochhaus wächst Stock um Stock und die nächste grosse Bauetappe auf dem Areal Torfeld Süd steht in den Startlöchern: Das neue Fussball-Stadion für den FC Aarau, mitsamt Einkaufszentrum, Multiplex-Kino und Wohnungen. Der Standort mitten im Zentrum war lange Zeit umstritten und gab im Städtchen entsprechend zu reden. "Planerisch ist es vielleicht kühn, aber ein Stadion mit seiner Magnetwirkung gehört in den Stadtkörper rein und nicht auf die grüne Wiese am Stadtrand. Es ist Teil des öffentlichen Lebens und hier mit dem öffentlichen Verkehr viel besser zu erreichen", sagt Fuchs. Wie in jeder Stadt stehen auch in Aarau etliche Bausünden. Um weitere zu verhindern, setzt Fuchs seit seinem Amtsantritt vor einem Vierteljahrhundert "überall, wo es geht und wo es sinnvoll ist", auf Architekturwettbewerbe. "Das kostet mehr Aufwand und mehr Denkanstrengungen, aber nach dem erfolgreichem Abschluss eines Bauprojektes habe ich nie jemanden gesehen, der gesagt hat, es habe sich nicht gelohnt". Ruhige Wohnquartiere Mit dem Hochhaus, dem Stadion, dem vor wenigen Jahren gebauten neuen Bahnhof und weiteren geplanten Wohn- und Geschäfts-Gebäuden ist rund um den Bahnhof ein neues, urbanes Aarau am entstehen. Südlich der Bahngeleise liegen die Gartenstadtquartiere. Es sind ruhige, inzwischen auch verkehrsberuhigte Wohnquartiere, die zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. PLACEHOLDER Diese "durchgrünten" Quartiere seien "städtebaulich von nationaler Bedeutung", schreibt der Schweizer Heimatschutz in seiner Begründung zur Vergabe des Wakker-Preises: "Um das Erscheinungsbild dieser Quartiere zu erhalten, nimmt die Stadt Aarau nicht nur Einfluss auf die Gestaltung der Gebäude, sondern hat auch erkannt, wie wichtig Umfriedungen, Bepflanzungen und Strassenräume für den Quartiercharakter sind." PLACEHOLDER Wohnen in diesen Quartieren gilt als attraktiv. Entsprechend gross ist der Druck von Besitzern und Investoren auf Neu-, Erweiterungs- und Umbauten. Die Stadt stehe hier "beratend zur Seite" und verfolge das Ziel, dass Neubauten "in einer massstäblichen Art in das bestehende Siedlungsgefüge eingepasst" würden, sagt Fuchs und räumt ein, es habe "auch Unglücke", also Neubauten gegeben, die nicht in die Umgebung passten, weil sie beispielsweise zu gross ausgefallen oder von zu viel asphaltierten Parkplätzen umgeben seien. "Aber anhand von einzelnen verunglückten Situationen ist auch die Bevölkerung darauf sensibilisiert worden, dass man bei Neubauten sorgfältig vorgehen muss." Die Altstadt wurde in den vergangenen Jahre saniert, herausgeputzt und vom Privatverkehr befreit. Der Stadtbach fliesst nicht mehr unterirdisch, er ist nun genauso Bestandteil des Stadtbildes wie das erneuerte Kopfsteinpflaster. Aarau hat sich gewandelt, ist gewachsen, ohne die Freiräume und Grünflächen anzutasten. Vom Rest der Schweiz wird Aarau jedoch immer noch kaum als attraktive Stadt wahrgenommen. Fuchs erklärt das auch mit dem Sog der grossen Zentren Zürich und Basel, von denen Aarau lediglich je weniger als 40 Kilometer entfernt ist: "Die Stadt stellt ihr Licht immer unter den Scheffel. Warum ist für mich bis heute nicht erklärbar. Es gibt viel Selbstkritik und Genörgel. Vielleicht trägt der Wakker-Preis dazu bei, das ein anderes Selbstbewusstsein entsteht." Wakker-Preis Der Schweizer Heimatschutz (SHS) vergibt jährlich einer politischen Gemeinde den Wakkerpreis. Aarau erhält den Preis 2014 am 28. Juni. Der Wakkerpreis zeichnet Gemeinden aus, welche bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung besondere Leistungen vorzeigen können. Das Preisgeld hat mit 20'000 Franken eher symbolischen Charakter, der Wert der Auszeichnung liegt in der öffentlichen Anerkennung vorbildlicher Leistung. Erstmals ermöglicht wurde der Wakkerpreis 1972 durch ein Vermächtnis des Genfer Geschäftsmannes Henri-Louis Wakker an den Schweizer Heimatschutz. Weitere seither eingegangene Legate erlauben es dem SHS, den Preis bis heute vergeben zu können. Die Auszeichnung von Stein am Rhein, Guarda, Ernen etc. in den 1970er-Jahren erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Erhaltung historischer Zentren nicht selbstverständlich war. Im heutigen Fokus stehen Gemeinden, die ihren Siedlungsraum unter zeitgenössischen Gesichtspunkten sorgfältig weiterentwickeln. Hierzu gehören insbesondere das Fördern gestalterischer Qualität bei Neubauten, ein respektvoller Umgang mit der historischen Bausubstanz sowie eine vorbildliche, aktuelle Ortsplanung.
(Michele Andina, swissinfo.ch)
Er war der erste Nicht-Amerikaner, der mit dem Thomas Nast Award ausgezeichnet wurde, nach dem Pulitzer-Preis die prestigeträchtigste Presse-Auszeichnung der USA. Seit 20 Jahren bringt der Schweizer Zeichner Patrick Chappatte seine Leserinnen und Leser dies- und jenseits des Atlantiks zum Lachen und Studieren. "Europa umzingelt uns! Die Grenzgänger sind unter uns! Die Ausländer überfüllen unsere Züge!", ist auf dem Rücken des neuen Buches mit über 120 Zeichnungen von 1992 bis 2014 ironisiert zu lesen. Die Themen Schweiz, Ausländer und Europa stehen im Zentrum, umringt von der omnipräsenten Figur des Volkstribuns Christoph Blocher und seiner rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP). Das Buch belegt einmal mehr die Schärfe des Blicks von Chappatte, die Präzision seines Strichs und seinen Sinn für Ironie und Spott, der aber nie ins Boshafte abgleitet. Patrick Chappatte, der 16 Bücher herausgegeben hat (darunter drei gezeichnete Reportagen), ist der Karikaturist der Genfer Tageszeitung Le Temps. Er arbeitet auch für die NZZ am Sonntag und die International New York Times. Im Internet ist er mit seinen Zeichnungen auf Yahoo! Actualités zu sehen. (Texte: Marc-André Miserez, swissinfo.ch) "Coupez!, la Suisse, l’Europe et les étrangers" von Globe Cartoon und Le Temps, 2014, 132 Seiten.
Die Art Basel, deren 45. Ausgabe am Donnerstag beginnt, ist die Kunstmesse, an der Aussteller und Besucher die neuesten Trends in Sachen Gegenwartskunst aufspüren. Schon mehr als ein Trend sind Künstler-Filme. Mittlerweile setzen viele Galerien auf dieses Format. Video hielt in den späten 1960ern Einzug in die bildende Kunst, als Pioniere wie Nam June Paik und Bruce Nauman bewegte Bilder in ihre Installationen integrierten. In den 1970er-Jahren war dann der Amerikaner Bill Viola der erste, der ausschliesslich auf Videos als Kunstform setzte. Heute interpretieren jüngere Künstler das Medium neu. Sie zählen zur Generation, die mit MTV aufgewachsen ist (Musik-TV-Sender, der sich an ein junges Publikum richtet, die Red.), und in deren Welt das digitale Bild regiert. Die Art Basel öffnete sich zwar schon 1999 dem Film. Damit würdigten die Organisatoren die Bedeutung des bewegten Bildes in der Ikonographie der Gegenwart. Mit der strategischen Erweiterung wollten sie aber auch eine neue Generation von Sammlern ansprechen, die stark auf die aktuellen Medien Video, Film, Audio sowie auf die computergestützten Technologien setzen. Art Basel Die Art Basel wurde vor 45 Jahren von drei Galeristen, u. a. Ernst Beyeler, gegründet. Damit gehört sie zu den ersten Kunstmessen weltweit. Jedes Jahr wirkt sie als Magnet für die wichtigsten Kunstgalerien der Welt, die in ihrem Schlepptau Sammler, Kuratoren, Künstler und andere Prominente mitbringen. Ursprünglich zum Verkauf moderner Kunst gedacht, wurde die Messe mehr und mehr zum Schaufenster für Gegenwartskunst. Die Organisatoren können nur ein Drittel aller Interessenten berücksichtigen. Vom 19. bis 22. Juni werden in Basel 300 führende Galerien aus Nord- und Lateinamerika, Europa, Asien und Afrika ausstellen. Erwartet werden auch Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern. Global präsent, regional ausgeprägt Die Filmsektion der Art Basel, die auf Einzelprojektionen beruht, ist mittlerweile auch fester Bestandteil der Franchisen Art Miami und Art Hong Kong. Die persönlichen Vorlieben der jeweiligen Kuratoren aber sorgt dafür, dass jede der drei Kunstmessen ihre ganz spezifische Prägung aufweist. Für die Miami Art Basel von kommendem Dezember plant David Gryn, Direktor des Artprojx in London, Film-Events mit hohem Unterhaltungsfaktor unter freiem Himmel. Diese sollen dem Glimmer und Glamour der Hauptstadt des Sonnenstaates Florida alle Ehre machen. In Basel und Hong Kong dagegen finden Vorführungen von Kunstwerken im Medium Film meistens in herkömmlichen Kinosälen statt. Li Zhenhua, Kurator der Art Basel in Hong Kong, der zwischen Zürich und Peking pendelt, ist ein anerkannter Künstler, Produzent und Kurator im Bereich Medienkunst (Media Art), einem Oberbegriff für künstlerische Arbeiten im Zusammenhang mit neuen Technologien, auch Digitale Kunst genannt. "Künstler aus dem Bereich Medienkunst wollen heute als Gegenwartskünstler wahrgenommen werden", sagt Zhenhua. In Basel hat in den letzten sieben Jahren der Berliner Film-Experte Marc Glöde den Bereich kuratiert. Dies zusammen mit Sammler This Brunner. Als Wissenschaftler, der sich für die Auswirkung der bewegten Bilder interessiert, bevorzugt Glöde Werke von hoher Komplexität. Befragt, nach welchen Kriterien er Filmwerke von Künstlern auswähle, nennt der Kurator deren Irritations-Potenzial. "In meiner Zeit in den USA begann ich mich mehr und mehr für Irritation zu interessieren", hält er lakonisch fest. "Während es für die Meisten etwas negatives war, regte Irritation mein Denken an. Meine Fähigkeit, überrascht zu sein, ist grösser, wenn ich nicht entspannt bin." Der Deutsche macht in seinem Tätigkeitsgebiet eine neue Energie aus. "Künstler haben immer versucht, die Einschränkungen des Bildschirms zu überwinden. Mit Beamern kann man Bilder mehr oder weniger überall projizieren." Um die Zauberei zu demonstrieren, die mit dem Beamer möglich werden, hat Pionier Bill Viola die Architektur des Münsters, der Berner Grosskathedrale, und diejenige des Kunstmuseums Bern mit fantastischen Bildern transzendiert. Kunstfilme haben laut Glöde eine neue Generation von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, welche die bewegten Bilder gewissermassen mit der Muttermilch aufgesogen haben, inspiriert. Einer dieser jungen Wilden ist Ryan Trecartin, der als neuer Komet am Kunsthimmel bejubelt wird. Zusammen mit seiner Partnerin Lizzie Fitch transformiert der 33-Jährige bonbonfarbene Video-Bilder von ihren Camping-Freunden in ein ausschweifendes Kaleidoskop. Wie viele seiner Kollegen veröffentlicht Trecartin seine Werke auf der Internet-Plattform Vimeo. So kann er riesiges Publikum erreichen, zugleich aber auch das traditionelle Geschäftsmodell der Galerien unterlaufen. PLACEHOLDER Boost durch technologische Entwicklung Zeitgenössische Kunst war noch nie der absolute Renner, wird aber immer gesuchter. Kunstmessen sind für die Galerien die beste Plattform, ihre Künstler zu präsentieren. Obwohl einige an allen drei Ausgaben der Art Basel präsent sind, stellen sie nie den gleichen Künstler zweimal aus. Hauser & Wirth, die führende Schweizer Galerie mit Filialen in London und New York, stellte in Hong Kong die gewinnenden "Aktions-Skulpturen" des Schweizer Künstlers Roman Signer aus. In Basel dagegen werden Hauser & Wirth den aufsehenerregenden Sterling Ruby sowie Rashid Johnson präsentieren, der sich stark mit Spiritualität auseinandersetzt. Meilensteine der Videokunst Als Gründer gilt der 2006 verstorbene Koreaner Nam June Paik. Doug Aitken verwendete grosse Bildschirme in Innen- und Aussenräumen und sprach von "flüssiger Architektur". In seinem Schaffen erkundet er die Wurzeln der Kreativität. Dan Graham baute ab 1969 Videobilder in Performances ein und lotete so insbesondere die Beziehung zwischen Körpern und Sprache aus Der Amerikaner Matthew Barney schafft skulpturale Installationen, die er mit Performance und Video kombiniert. Bill Viola gehört zu den Pionieren, der mit dem Medium Video grundlegenden und existentiellen Lebenserfahrungen wie Bewusstlosigkeit erforscht. Mit Aitken einer der wenigen, die ausschliesslich mit dem bewegten Bild arbeiten. US-Künstler Bruce Nauman ist ein Multimedia-Künstler, dessen Videos oft auf den menschlichen Körper fokussieren und sehr verstörend wirken können. Die Schweizerin Pipilotti Rist zählt zu den international ganz Grossen der visuellen Künste. Ihre Werke zeichnen sich durch eine ansteckende Heiterkeit und Ausgelassenheit aus. Diese werden durch farbige Bilder transportiert, die hauptsächlich um das Thema des Frauseins kreisen. Kunst mit bewegten Bildern sei schon seit langer Zeit Teil des Kunstangebots und habe stets zum Verkaufsprogramm der Galerien gehört, sagt Florian Berktold, Leiter von Hauser & Wirth. "In den letzten fünf Jahren aber haben sich die technologischen Möglichkeiten stark verändert: die erweiterte Infrastruktur für eine bessere Bildqualität, die Grösse der Kameras, die Bearbeitung von Bild am Computer, von Tönen auf dem iPhone und die fortgeschrittenen technischen Standards", zählt Berktold auf. Kunstfilme/Filmkunst Während 50 Jahren wurde Film als Kunst vorwiegend konzeptuell eingesetzt oder als Teil von Performances oder Installationen. Das wegweisende Schaulager in Basel hat in einer Folge vier Künstler von Weltformat präsentiert, alles Männer: Matthey Barney, Francis Alÿs, Steve McQueen und Paul Chan. Pipilotti Rist aus der Schweiz und Gillian Wearing aus Grossbritannien gehören in diesem männerdominierten Bereich zu den grossen Ausnahmen. In der Bildschirm-orientierten Domäne schaffen die Künstler neue Blickwinkel auf die Welt. In den letzten beiden Jahren ging der prestigeträchtige Turner Preis an Frauen: Die Britin Elizabeth Price hob die Videokunst in neue Dimensionen, während 2013 die Französin Laure Prouvost die Auszeichnung für ihre Installation "Wantee" erhielt. Sie versteht ihr Schaffen als eine Erfahrung, ähnlich jenes Gefühls, wenn die Sonne auf die Haut scheint, wie sie es in einer ihrer jüngsten Arbeiten umsetzt.
(RTS "le journal", swissinfo.ch) Bill Viola ist eine herausragende Figur der zeitgenössischen Kunstwelt. Er hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Kunstform Video zu einer der zentralen Formen der Gegenwartskunst wurde. Während seiner gesamten Karriere war Viola ein Erneuerer, der mit dem gesamten Instrumentarium des Videokünstlers experimentierte: Extreme Zeitlupe, Endlosschlaufen, Installationen auf mehreren Bildschirmen und Infrarot-Überwachungskameras, wie sie meist in Banken eingesetzt werden. Mit diesen Möglichkeiten schafft es Viola, das Unsichtbare festzuhalten und auszudrücken: die Zeit, die Kraft der Elemente, Illusionen, den Tod. Das Berner Kunstmuseum kaufte erste Werke in den 1990er-Jahren. Heute gehören sie zur Dauerausstellung. Gegenwärtig werden vier weitere Werke von Viola ausgestellt, mit einer bis zwei Video-Projektionen pro Raum im gesamten Gebäude. Zusätzlich werden fünf von Violas jüngeren Arbeiten im Berner Münster gezeigt. Diese beziehen sich auf spirituellere Themen und zeigen Menschen und symbolische Szenen mit einem Bezug auf die Liturgie. In den Videos geht es um Reinigung, Wandlung und menschliches Mitgefühl.
Dieser Unterricht ist neu für die Schüler im Nordosten Brasiliens: In Salvador de Bahia sollen junge und weniger junge Bildungshungrige interaktive Kurse in rund 70 Themenbereichen absolvieren können. Möglich macht dies der Schweizer Honorarkonsul Daniel Kunz. In seinen 20 Jahren in Brasilien hat Daniel Kunz ein weitverzweigtes Beziehungsnetz aufgebaut. Einem seiner Kontakte, nämlich Aldo Freitas, dem Gründer der Privat-Universität UniJorge in Salvador de Bahia, verdankt Kunz die Idee, dort die Berufsbildung zu fördern. Vor fünf Jahren hatte Freitas die ersten Schulen "Digitale Ära in der Berufsbildung" eröffnet. Heute führt er in Salvador de Bahia neun solche Institute und eines in Recife. "Das beweist, dass dieses Berufsbildungs-Modell einer Nachfrage entspricht", sagt Kunz. Der Honorarkonsul hat nach Freitas' Vorbild nun seine eigene Schule eröffnet, die ebenfalls auf Computer-gestütztem, also digitalen Unterricht beruht. In den Freitas-Schulen "Digitale Ära in der Berufsbildung" können Absolventen interaktive Lehrgänge in rund 70 Berufs- und Tätigkeitsbereichen auswählen. Die Materie wird von Fachpersonen vorbereitet. Möchte jemand beispielsweise Kassierin oder Kassierer in einem Supermarkt werden, folgt die Person an einem der 16 Computer im Zimmer einem audio-visuellen Kurs, in dem sämtliche Schritte der Tätigkeit gezeigt und erklärt werden. Auf einer virtuellen Registrierkasse können die Absolventen beispielsweise erste Additionen wie auch Subtraktionen tippen. PLACEHOLDER Jeder nach seinem Rhythmus Im Laufe des Unterrichts müssen die Absolventen regelmässige Zwischenprüfungen ablegen. Darin müssen sie unter Beweis stellen, dass sie 70% des Stoffes beherrschen. Wer einen Test nicht besteht, muss das Kapitel wiederholen, in dem er oder sie noch zu wenig sattelfest ist. Die Zahl der Versuche ist bewusst nicht limitiert. "Das ist für jene ein Vorteil, die Mühe mit Lernen haben", erklärt Kunz. Die Lernenden können den Online-Kurs jederzeit unterbrechen, um Eulinela Vergne De Asssis Barbosa Fragen zu stellen. Die Lehrerin ist während aller Lektionen im Klassenzimmer anwesend. "Das ist einer der Hauptunterschiede zu einem Fernkurs, wo jeder Lernende allein vor seinem Bildschirm sitzt", sagt Kunz. Klar sind keine technischen Kurse im Angebot, die viel Handfertigkeit verlangen - an Kunz' Schule kann man nicht Koch oder Mechaniker werden. Die einjährige Ausbildung absolvieren die Lernenden ausschliesslich am Bildschirm. Wöchentlich finden zwei Lektionen statt, entweder am Vor- oder Nachmittag. Daniel Kunz' Institut liegt in Brotas, einem Arbeiterquartier. Die moderaten Kurskosten liegen bei umgerechnet 33 Franken pro Monat. "So haben die meisten Zugang. Beispielsweise die Älteren, die einen Einführungskurs in die Informatik benötigen und die 15% der Lernenden ausmachen", sagt der Gründer. PLACEHOLDER Fit für den ersten Job Aber Lernen allein bringt noch nichts. Deshalb hat der Honorarkonsul fünf seiner Freunde, die Informatikunternehmen oder Supermärkte führen, davon überzeugt, regelmässig an seine Schule zu kommen, um dort mit den besten Absolventen Vorstellungsgespräche abzuhalten. Diesen winkt dann eine fixe Anstellung als Kassiererin, Verkäufer, Rezeptionistin, Buchhalter, Grafikerin oder Informatiker. Klappt es nicht gleich mit einer Festanstellung, sind auch Praktika möglich. "Oberstes Ziel unserer Berufsbildungs-Kurse ist die Vorbereitung unserer Schüler auf ihre erste Stelle", erklärt Gründer Kunz. In Brasilien bestünden gerade im Bereich der Ausbildung grosse Defizite, fährt er fort. "Meine fünf Freunde führen als Unternehmer zusammen 6000 Mitarbeitende. Sie alle beklagen, dass sie jedes Jahr 30% ihrer Beschäftigten entlassen müssen, weil diese über keine genügende Grundausbildung verfügen." Für den brasilianischen Bundesstaat Bahia sei die öffentliche Berufsbildung eine Priorität, sagt Almeiro Biondi Lima vom regionalen Bildungsdepartement. Mit finanziellen Investitionen werde insbesondere das Kursangebot im Bereich der technischen Berufe vergrössert. So schafft der Bundesstaat Bahia jedes Jahr 45'600 Plätze in technischen Ausbildungskursen auf mittlerem Niveau. Diese Lehrgänge sind kostenlos, dauern zwischen zwei und vier Jahren und finden in Partner-Institutionen statt. Vielseitiges Engagement Der 46-jährige Daniel Kunz ist seit fünf Jahren Schweizer Honorarkonsul im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Der gebürtige Thurgauer lebt seit 20 Jahren in Brasilien, "weil das Land Chancen ermöglicht", wie er sagt. Kunz ist mit einer brasilianischen Anwältin verheiratet, mit der er einen zehnjährigen Sohn hat. Er besitzt mehrere Geschäfte und arbeitet als Immobilienagent in Salvador. Nach einer Ausbildung in der Schweiz als Flugzeug-Mechaniker machte er ein MBA in Marketing in São Paulo sowie ein MBA in Projektmanagement an der UniJorge in Salvador. Keine Chancengleichheit Im riesigen Land grassiert die Ungleichheit. Viele Kinder und Jugendliche brechen ihre Schulausbildung vorzeitig ab. William Azevedo Dunningham, Professor für Sozialpsychiatrie an der Universität Bahia, nennt die wichtigsten Gründe dafür: "Viele Eltern können die Bedürfnisse ihrer Kinder im Schulalter gar nicht befriedigen. Im Nordosten werden Mädchen mit 15 schwanger und sind mit der Erziehung ihrer Kinder völlig alleingelassen. Auf dem Land helfen die Jungen sehr früh ihren Eltern in den Pflanzungen. Die Jungen wollen schnell Geld verdienen, und wenn möglich leicht…." Dazu komme die Sozialgeschichte Brasiliens, mit einer kleinen Minderheit an kultivierten Reichen, und einer grossen Mehrheit an wenig gebildeten Armen, gibt Dunningham zu bedenken. Diese Geschichte lasse sich nicht von einem auf den anderen Tag auslöschen, auch wenn die Mittelschicht zahlenmässig zunehme.
(Michele Andina, swissinfo.ch)
Seit vielen Jahren fotografiert der Freiburger Romano P. Riedo Menschen, Tiere, Ereignisse und Dinge, die mit der Alpwirtschaft verbunden sind. Sein erster Bildband zu diesem Thema liegt beinahe zwanzig Jahre zurück – der Titel des Buches damals "Alpzeit". Nun liegt die Fortsetzung vor: "Hinterland". Riedos Reportagebilder, wenn man das Resultat einer langjährigen Arbeit denn so nennen kann, wurden kürzlich mit einem Swiss Press Photo 2014 Preis ausgezeichnet. Es ist spürbar, dass Riedo das Leben und die Arbeit mit den Tieren auf der Alp aus eigener Erfahrung kennt. Seine Aufenthalte als Alphirte fasst er so zusammen: "Es gibt viel Einsamkeit auf der Alp" – neben der strengen Arbeit also viel Zeit, Gedanken nachzuhängen. Er ist wohl selber viele Male über den Stacheldrahtzaun gestiegen, bevor er sich dazu entschieden hat, den im spitzen Draht verfangenen Büschel mit Kuhhaar zu fotografieren. Er hat das grobe Leinen des frisch gemachten Bettes mit eigener Hand glattgestrichen und das Holzscheit zum Anzünden des Feuers unzählige Male fächerförmig angeschnitten, bevor er sein Auge durch die Kamera darauf richtete. Entstanden sind dabei Bilder, die uns einen kleinen Blick ins Leben im "Hinterland" ermöglichen. Einen Ort, der Teil ist unserer Welt, den wir aber oft nicht mehr wahrnehmen, weil es dazu Zeit braucht – und Ruhe. Riedos Bilder laden dazu ein, sich diese Zeit zu nehmen. Der Fotograf bedient sich bewusst der schwarz-weissen Fotografie und benutzt analoge Technik. Nicht weil er Purist ist oder Traditionalist, sondern weil diese Technik dem Gegenstand seiner Arbeit am besten entspricht. Die Langsamkeit des Lebens, das Riedo dokumentiert, setzt sich im aufwändigen Prozess der Verarbeitung in der Dunkelkammer fort. Der Verzicht auf Farbe erleichtert es uns, mit dem Blick nicht an der Oberfläche haften zu bleiben und für einen Moment ins Bild versinken zu können. Mit "Hinterland" könnte auch das Leben hinter den Bildern gemeint sein, die Bedeutung der Dinge, die sich einem erst bei wiederholtem Betrachten offenbart. Alle Bilder: Romano P. Riedo / fotopunkt.ch Text: Thomas Kern / swissinfo.ch
Aus den 66 Pavillons, die dieses Jahr an der Architekturbiennale in Venedig präsentiert werden, wird der schweizerische höchstwahrscheinlich herausragen. Kurator Hans Ulrich Obrist erklärt, wie er mit den Architekten Herzog & de Meuron und zahlreichen Künstlern einen "Spasspalast" erschaffen hat. Als Startpunkt diente – wie bei allen nationalen Pavillons – das Thema "Absorbing Modernity 1914 – 2014". Leiter der 14. Architekturbiennale ist der renommierte niederländische Architekt Rem Koolhaas. Er lud die teilnehmenden Länder dazu ein, ihre architektonische Geschichte wiederaufzugreifen, um sie als Werkzeugkasten für künftige Erfindungen zu nutzen. Hans Ulrich Obrist, bekannt als eine der prägendsten Figuren der Kunstszene, wurde von der Biennale-Jury der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia gewählt, um den diesjährigen Pavillon nach dem Vorbild seiner bahnbrechenden "Utopia Station" der Kunstbiennale 2003 in Wien zu gestalten. Er entschied sich dafür, zwei visionäre Denker zu ehren, die das zeitgenössische Architekturdesign massgebend beeinflusst haben, und die er gut kannte: Lucius Burckhardt und Cedric Price. Doch statt eine Ausstellung zu machen, schlägt Obrist mit seiner kennzeichnenden kuratorischen Note eine kreative Plattform vor, am Kreuzungspunkt von Kunst und Architektur. Burckhardt, ein Schweizer Polit-Ökonom und der Erfinder der "Spaziergangswissenschaft", und der britische Architekt Price haben laut Obrist "die Architektur als sich um Menschen, Raum und Leistung drehend" neu definiert. Beide Männer sind 2003 gestorben. In einfachen Worten gesagt, waren sie die ersten, die an die Architektur nicht aus der Perspektive des Erbauers (wie?) herangingen, sondern in Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse der Benutzer (warum?). PLACEHOLDER Spasslabor "A stroll through a fun palace" (Ein Spaziergang durch einen Spasspalast), wie das Pavillon-Projekt genannt wird, nimmt Bezug auf Price' einflussreichstes Design. Sein Fun Palace von 1961 war eine Pionierleistung, weil er das Konzept vertrat, dass ein Gebäude unbeständig und flexibel sein sollte, und dass der Benutzer es fertigstellen könne. Noch wichtiger: Es sollte ein "Spasslabor" sein. "Sehr wenige Architekten haben die Architektur mit so wenigen Mitteln verändert", sagte Koolhaas über Price, der nur sehr wenige Bauten realisierte. Obrists Projekt hat viele Facetten, die er mit einem Cocktail aus Architekten, Künstlern und Wissenschaftlern gemeinschaftlich erarbeitet hat. "Ich habe mich von Sergei Djagilew inspirieren lassen", sagt Obrist. "Mich interessiert die Idee, Disziplinen zusammenzubringen, um ein Gesamtkunstwerk zu schaffen." Djagilew, der Gründer der "Ballets Russes" zu Beginn des 20. Jahrhunderts, brachte alle Kunstformen zusammen, als er Strawinsky die Musik komponieren, Picasso die Dekors malen und Nijinsky tanzen liess. Jenen, die mit ihm arbeiten wollten, antwortete er: "Überraschen Sie mich!" Schweizer Pavillon "Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun palace" wird im Schweizer Pavillon von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia präsentiert. Die Architekturbiennale dauert vom 7. Jun bis 23. November. Während des Sommers werden Studierende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), wo Burckhardt lehrte, und anderer Institutionen mit Besuchenden in Dialog treten und an verschiedenen Tagen unterschiedliche Teile der Archive offenlegen. Die Show wird als Architekturschule dienen, in der darüber reflektiert wird, wie sich die zeitgenössische Architekturlandschaft verändert. Kurator Hans Ulrich Obrist sagt, der Schweizer Pavillon "wird ein Rendezvous von Fragen sein", mit Debatten und Marathons, während denen "Information Wissen wird". Während der Eröffnungstage wird eine Reihe von Diskussionen über Architektur, Landschaftsgestaltung und Darstellungsmöglichkeiten durchgeführt. Die Anzahl der teilnehmenden Länder an der Architekturbiennale ist gegenüber der letzten Austragung um 20% angestiegen. Kreative Störung Laut Obrist hätten sowohl Price wie auch Burckhardt die Idee einer statischen Ausstellung gehasst: "Sie hätten eine performative Art gefunden, ihre Archive zu präsentieren, in denen sich auch viele Bilder befinden. Sie wollten Künstler miteinbeziehen, weil diese ständig auf der Suche nach neuen Formaten für Ausstellungen sind." Die Künstler, die Obrist eingeladen hat, standen alle bereits einmal in einem Dialog mit der Architektur. Er organisierte eine Reihe von "Think Tanks" (er nennt sie auch "Kollaboratorien"), um eine mobile Darstellungsform für den Pavillon auszuarbeiten, "eine, die immer lebendig bleibt, bei der jeden Tag verschiedene Aspekte der Archive entdeckt werden können". Obrist fragte zuerst die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron für jenen Teil der Ausstellung an, der deren ehemaligem Lehrer Lucius Burckhardt gewidmet werden sollte. Doch rasch wurde klar, dass sie auch das gesamte Design des Pavillons übernehmen würden. "Herzog & de Meuron haben oft mit Künstlern wie Thomas Ruff und Gerhard Richter gearbeitet, daher dachte ich, es könnte interessant werden, sie mit einer jüngeren Generation von Künstlern zusammenzubringen, mit der sie noch nie gearbeitet haben", so Obrist. "Je länger wir redeten, desto weniger 'physisch' wurde die Ausstellung. Schliesslich entschieden sie sich für ein Konzept , das in ihren Worten erlaubt, dass 'das mentale Universum von Lucius und Cedric im Raum schwebt'." Wie ein mentales Universum in den Augen jener Architekten aussehen mag, die für die Tate Modern und das Vogelnest-Stadion in Peking berühmt geworden sind, wird dem Publikum ab dem 7. Juni vor Augen geführt. Hans Ulrich Obrist Der 1968 in Zürich geborene Hans-Ulrich Obrist ist heute Co-Direktor Ausstellungen und Programme an der Serpentine Gallery in London, gemeinsam mit Julia Peyton-Jones. Er hat schon mehr als 250 Ausstellungen kuratiert und engagiert sich im laufenden "Interview Project". Seit er als Teenager die Architekten Herzog & de Meuron getroffen hatte, interessierte er sich in seiner Arbeit als Kurator auch für die Architektur. Jeden Sommer lässt die Serpentine Gallery von einem weltbekannten Architekten einen Sommerpavillon bauen. Für seine "Utopia Station" an der Kunstbiennale 2003 in Wien liess er Sprecher, Schriftsteller, Tänzer, Performer und Musiker ein Projekt ausarbeiten, "das zwischen innen und aussen oszillierte". Die Antwort der Künstler "Für die Künstler war die Idee dieser Ausstellung in einem experimentellen Format eine Inspiration", sagt Obrist. Er arbeitet bei Projekten, bei denen ein transdisziplinärer Ansatz und eine Form störender Kreativität nötig ist, oft mit der gleichen Gruppe von Künstlern. Darunter der französische Künstler Philippe Parreno, der kürzlich das gesamte Palais de Tokyo in Paris bespielte. Er ist weitherum bekannt dafür, Ausstellungen erfolgreich als Experimente umzudefinieren. Er setzt zu diesem Zweck eine Vielzahl von Medien ein. Für den Schweizer Pavillon hat er ein System von Jalousien entworfen, um den Raum zu strukturieren. Ihm zur Seite stehen Dominique Gonzalez-Foerster, bekannt für ihre inspirierenden Neonschriften, und der Berliner Tino Seghal, dessen "konstruierte Situationen" zum Vergänglichsten gehören, was Kunst sein kann. Carsten Höller, der verspielte Installationen schafft, hat einen Baum gepflanzt. Und auch weitere Künstler werden Burckhardt and Price ihre Ehrerbietung erweisen, wie etwa der Turner-Preis-Gewinner Liam Gillick, Dan Graham und die immer wieder überraschende Koo Jeong-a. Diese zeigt ihre Installation "Cedric & Frand", ein Werk aus 3000 Magneten (1997 hatte Price eine Show namens "Magnets" zum Thema antizipierter Architektur präsentiert). Über dem Eingang zum Schweizer Pavillon erlaubt eine starke visuelle Intervention des japanischen Architektur-Ateliers "Bow-Wow" eine neue Sicht vom Dach aus auf die Giardini, in denen die Biennale stattfindet. Price und Burckhardt würden zweifellos ihre Freude gehabt haben: Ihre visionäre Sicht der Dinge hat mitgeholfen, dass der Schweizer Pavillon "ein Spaziergang durch einen Spasspalast" geworden ist – weit weg von der Normalität statischer Ausstellungen. Burckhardt und Price Lucius Burckhardt (1925–2003) war ein Schweizer Polit-Ökonom, Soziologe und Kunsthistoriker, der die "Spaziergangswissenschaft" (Promenadologie) erfand, mit dem Ziel, die Umweltwahrnehmung zu erweitern. Als Planungstheoretiker integrierte er die sicht- und die unsichtbaren Aspekte der Städte, politische und wirtschaftliche Überlegungen wie auch soziale Beziehungen in den Prozess. Seine Lehre gewinnt immer mehr Einfluss, besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit. Er förderte die Idee, Objekte umzudefinieren, statt neue anzuschaffen. Cedric Price (1934–2003) war ein englischer Architekt und einflussreicher Architekturlehrer und -schriftsteller. Architektur sollte für ihn nicht definitiven ästhetischen Meinungen unterworfen sein, sondern für den Nutzer flexibel bleiben. Über sein berühmtes Projekt, den nie gebauten "Fun Palace" (1961), schrieb er: "In Form und Struktur eine grosse Schiffswerft, in der Theater, Kinos, Restaurants, Ateliers, Säle fortlaufend erstellt, bewegt, neu gruppiert und auseinandergenommen werden können". Das revolutionäre Pariser Centre Pompidou (1977) wurde durch den Entwurf zum Spasspalast inspiriert.
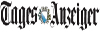
Fernbusse wecken Fernweh. Wir suchen und spielen Songs über die Sommerferien und das Verreisen. Der gelungenste Vorschlag wird prämiert.
An der Technologie-Konferenz TED in Berlin widerlegte der Ökonom Ted Piketty den Optimismus der anderen Redner mit Daten.
Wer das Beisstabu übertritt, bekommt die ganze Härte zivilisatorischer Verachtung zu spüren. Oder wie war das im Chindsgi?
Er war Don Altobello in «Der Pate» und er war Tuco in «The Good, the Bad and the Ugly». Der Schauspieler Eli Wallach verlieh Filmschurken Stolz und Würde. Nun ist er im Alter von 98 Jahren gestorben.
Sollte die US-Regierung «The Interview» mit James Franco und Seth Rogen nicht verbieten, droht Diktator Kim Jong-un mit «gnadenlosen Konsequenzen».
Die von Skandalen umrankte Musikerin Courtney Love wird 50. An einem Podiumsgespräch in Cannes erzählte sie, wie sie berühmt wurde und warum sie Miley Cyrus mag.
Fussball ist Religion, und die Fernsehkommentatoren sind deren Verkünder. Dass Gleiches dabei anders interpretiert werden kann, zeigt das Protokoll des Spiels Schweiz gegen Frankreich.
SRF versäumte es gestern, «Literaturclub»-Moderator Stefan Zweifel nach seiner überraschenden Absetzung anständig zu verabschieden. Stattdessen gabs Überheblichkeit.
In Manaus im brasilianischen Urwald tritt die Fussball-Nati heute zum WM-Spiel an. Eine gute Gelegenheit, die Dämonen des Dschungels zu beschwören. Ein letztes Mal.
Philosoph Peter Sloterdijk vertritt in seinem neuen Buch die These, dass Revolutionen und Emanzipationsbewegungen die Welt ins Chaos gestürzt haben.
San Francisco und Los Angeles haben das Nachsehen: George Lucas will sein Science-Fiction-Werk nämlich in Chicago ausstellen. 2018 soll das «Lucas Museum of Narrative Art» eröffnet werden.
Die täglichen Kultur-Kritiken auf .
Das Manuskript für Bob Dylans «Like a Rolling Stone» ist zu einem Rekordpreis versteigert worden. Der Sänger hatte die Textzeilen vor 50 Jahren auf Hotel-Briefpapier gekritzelt.
Adolf Hitler sei ein Steuerbetrüger gewesen, vermelden Medien dieser Tage. Taufrisch ist die Geschichte freilich nicht. Ein Kommentar.
Fake-Jubel ja, Flitzer nein: Wie die Fifa und ihre TV-Regie unsere Wahrnehmung der WM beeinflusst.























